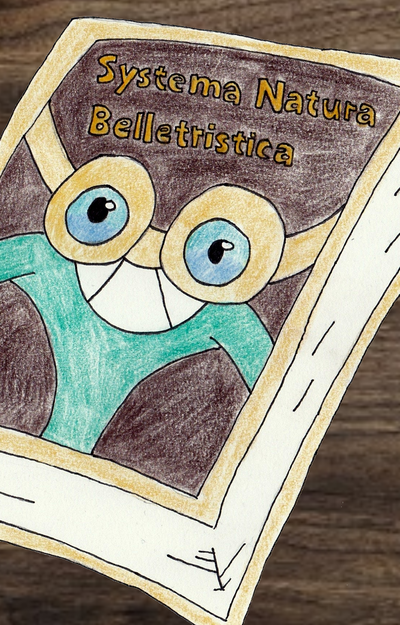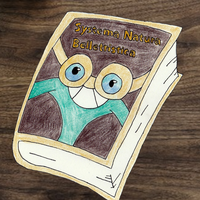Definition des Registers
Der Himmelswal (Balaeroptera levitate) ist eine in den höheren Luftschichten vorkommende Walart Belletristicas. Es handelt sich um eine der wenigen Walarten, welche zusätzlich Energie durch Feenstaub bezieht.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Synapsiden (Synapsida)
Ohne Rang: Theria
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria)
Überordnung: Laurasiatheria
Unterordnung: Whippomorpha
Teilordnung: Wale (Cetacea)
Kleinordnung: Bartenwale (Mysticeti)
Überfamilie: Balaenopteroidea
Familie: Balaenopteridae
Gattung: Balaeroptera
Spezies: Balaeroptera levitate (Himmelswal)
Beschrieben: MARV 2020
Unterart(en): Bisher keine bekannt
Merkmale
Der Himmelswal ist mit einer Länge von maximal 14,5 Metern ist der Himmelswal, dass größte "fliegende" Säugetier. Von einem aktiven Flug kann dabei nicht wirklich gesprochen werden, da der Himmelswal aufgrund seiner geringen Masse zum Volumen (im Schnitt 250 Kilogramm auf etwa 267,5 m²) eine geringere Dichte als Luft besitzt. Die Dichte von Luft beträgt 1,2 Kg/m³, während die Dichte des Himmelswals im Maximum 1,05 Kg/m³ beträgt. Daraus folgt die Möglichkeit des Schwebfluges für den Himmelswal. Was für den Giganten, einige Anpassungsprobleme bedeutet hat. Im Gegensatz zu anderen Walen wird der Himmelswal nicht durch umliegendes Wasser stabilisiert, der Stabilitätsverlust wirkt sich negativ auf den Walkörper aus, da dessen Stützelement (das Walskelett), fast nur aus Spongiosaknochen besteht. Diese Knochen sind leicht, elastisch, aber auch weniger stabil als Kompaktknochen von landlebenden Säugetieren. Um dem Stabilitätsverlust auszugleichen, sind die Knochen des Himmelswals stabiler gebaut und weniger elastisch. Des Weiteren wird vom Wal selbst, über Drüsengewebe unter der Haut, ein zäher Wasserfilm gebildet, der den Körper wie in einer maßgeschneiderten Blase umgibt und so der Stabilisierung des Körpers dienlich ist. Wenige Minuten nach der Sekretion färbt sich die zunächst farblose schweißähnliche Flüssigkeit blau. Auf der Hautoberfläche behält sie für einige Stunden ihre Farbe, bevor sie zerfällt. Ähnlich wie Schweiß hilft das Sekret den Tieren dabei, die Körpertemperatur zu regulieren.
Eine Studie des Biotopenparks konnte aus dem alkalischen Schleim zwei saure Pigmente isolieren, die für die ungewöhnliche Farbreaktion verantwortlich sind: den blauen Farbstoff Cetosudorische Säure (Cetos = Wal, Sudor = Schweiß), den weißen Norcetosudorische Säure. Beide können ultraviolette Strahlung effektiv abschirmen. Das blaue Pigment hat zudem antibiotische Eigenschaften. Bereits in sehr geringen Konzentrationen weit unter denen im natürlichen Schleim hemmt es das Wachstum von Krankheitserregern. Dieser Schutz genügt dennoch nicht, um den Wal vor aller UV-Strahlung des Luftraums abzuschirmen, bei starkem Sonnenschein ziehen sich die Wale in Wolken zurück. Können sie keine Wolken finden, bleiben ihnen meist nicht mehr als 12 Stunden, um ein Austrocknen zu vermeiden.
Der Wasserbedarf wird großteils durch ein spezielles Trinkverhalten gedeckt. Dafür fliegt der Wal auf dem Rücken in eine Wolke oder einen Nebel. Durch Kondensation wird das Wasser der Umgebung flüssig und läuft über die Furchen des Wals in dessen Maul. Der bogenförmige Oberkiefer des Wals verhindert dabei einen Verlust von Wasser. Um so seinen Wasserbedarf zu decken, muss der Wahl mindestens 2 Stunden den Tag auf dem Rücken durch Wolken und Nebel fliegen.
Auch wenn der Himmelswal hauptsächlich durch seine geringe Dichte zum Schwebeflug gelangt, kann er durch kräftiges Ein- und Ausatmen seine Höhe beeinflussen. Sein Blass ist daher reine Druckluft und kann den Wal kurzzeitig bis zu 100 Meter in die Tiefe drücken.
Verbreitung
Himmelswale treten häufig in feuchtkühlen Lebensräumen auf, wie Nebelwäldern, gemäßigten Regenwäldern und über den Ozeanen. Dabei treten sie über den Meeren, insbesondere über der Hochsee, deutlich häufiger auf. Über Kulturräumen und Wüsten sind sie nur im Fall einer Verirrung anzutreffen.
In der Regel trifft man Himmelswale im Luftraum von 5 bis 13 Kilometern an.
Lebensweise
Ernährung
Himmelswale ernähren sich von Luftplankton, winzigen biologische Organismen wie z. B. Insekten, Spinnen, Algen, Viren, Bakterien, Pollen, Sporen, Pflanzensamen. Außerdem vertilgen sie Feenstaub, welcher in den höheren Lagen in Wolken gebunden erscheint.
Da Himmelswale vornehmlich an den Rändern der belletristicanischen Grenzen vorkommen, existiert schon seit längerem die Theorie, dass die riesigen Tiere den Jetstream von Feenstaub filtern, was erklären würde, warum Feenstaub im Rest der Welt eine Seltenheit darstellt. Diese Theorie konnte bisher aufgrund der Schwierigkeiten bei der Himmelswalforschung nicht ermittelt werden.
Fakt ist, dass Himmelswale, die nicht täglich mindestens 5 Kilogramm Feenstaub zu sich nehmen, binnen weniger Tage am Boden stranden und verenden, egal wie viel Luftplankton sie zu sich nehmen, offenbar ist der Feenstaub relevant für ihre Fähigkeit zu fliegen.
Verhalten
Über die Lebensweise ist wenig bekannt. Sie scheinen eher langsamer Flieger zu sein, die sich gerne zu sozialen Verbänden zusammenschließen. Sie scheinen zur Morgen- und Abenddämmerung aktiver, mittags zeigen sie nur eine Bewegungsbereitschaft, wenn es regnet oder es bald regnen wird. In einem Fall wurde eine Gruppe von acht Himmelswalen beobachtet.
In Abständen von etwa 10 bis 15 Minuten rufen die Himmelswale einen spezifischen Ruf, dieser teilt sich in einen für den User hörbaren und einen Infraschallruf auf. Mit dem Infraschall werden anderen Himmelswale informiert, dass in einer bestimmten Distanz sich bereits eine Himmelswalgruppe befindet, so wird vermutlich Nahrungskonkurrenz vermieden. Der hörbare Ruf ist dabei eine positive Begleiterscheinung für die Luftfahrt.
Fortpflanzung
Die Geschlechtsreife erreichen Himmelswale wohl erst im Alter von 40 oder 50 Jahren, genauere Angaben liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Nach rund einjähriger Tragzeit bringt das Weibchen von Juni bis November ein rund fünf bis sechs Meter langes, 35 bis 52 Kilogramm schweres Kalb zur Welt. Vor der Geburt steigt das Weibchen in die maximale Flughöhe auf. Wenn das Kalb geboren wird, fällt es mehrere hunderte Meter in die Tiefe, dabei füllt sich seine Körper, insbesondere die Luftkammern im Inneren, rasant mit Luft und verlangsamen so den Sturz, wie bei einem gezogenen Fallschirm. Die Mutter eilt ihrem Kalb nach, um unter es zu gelangen. Hat die Mutter das Kalb auf ihrem Rücken liegen, verbringt es die nächsten vier bis sechs Stunden dort, erst dann ist es vollständig flugfähig und kann der Mutter folgen. Das Kalb wächst sehr schnell, bis zu drei Zentimeter pro Tag, und wird rund vier bis sechs Monate lang gesäugt.
Die Lebenserwartung der Himmelswale ist weitgehend unklar, Untersuchungen an Kadavern ergaben, dass die Tiere um die 200 Jahre alt werden können, vermutlich älter.
Gefährdung
Vor allem durch die im Frühling und Sommer an den Südküsten Belletristicas geschwemmten Kadaver ist der Himmelswal bekannt geworden. Dagegen wird er über dem offenen Meer nur selten gesehen und noch seltener im Inland. Da er, aufgrund seiner Luftlebensweise, nie bejagt wurde, geht man davon aus, dass diese Spezies niemals besonders häufig war.
Genaue Populationsangaben sind nicht bekannt, die BCS stuft die Art als vom Aussterben bedroht ein, da sie empfindlich auf trockenere Klima und Luftverschmutzung reagieren.
Eine erste Nachzucht erfolgt im Biotopenpark.
Kulturelle Bedeutung
Gefährlichkeit
Himmelswale sind aufgrund ihrer Größe für Luftschiffe ein nicht ungefährliches Hindernis. Da sie sich bevorzugt in Wolken oder Nebel aufhalten, sollte man diese nur mit Vorsicht passieren. Aufgrund ihrer seltenen Häufigkeit im Inland sind Zusammenstöße mit Himmelswale aber eine Seltenheit. Häufig reicht der markante Ruf der Giganten, um einem kundigen Kapitän zu vermitteln, dass er eine gewisse Wolke oder einen gewissen Nebel eher meiden sollte.
Systematik
-
Anmerkungen
-