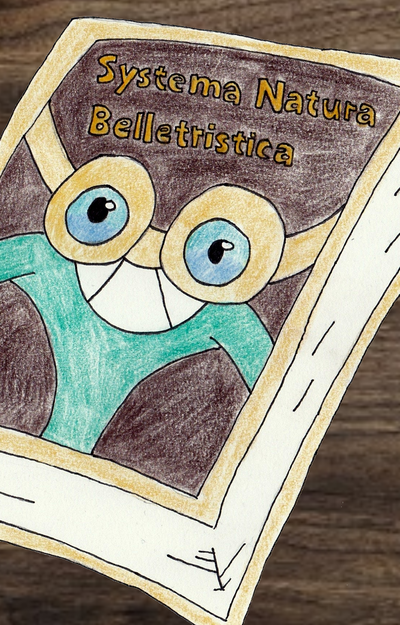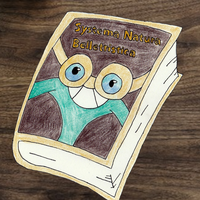Definition des Registers
Der Schneeschieb-Bär (Pesplanus nix) ist eine Bärenart des Kontinents Belletristicas. Seite verbreiterten Füße sind nach Hinten gebogen, sodass er Schneemassen hinter sich aufschieben kann.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Synapsiden (Synapsida)
Ohne Rang: Theria
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria)
Überordnung: Laurasiatheria
Ordnung: Raubtiere (Carnivora)
Unterordnung: Hundeartige (Caniformia)
Familie: Bären (Ursidae)
Unterfamilie: Ursinae
Gattung: Pesplanus
Spezies: Pesplanus nix (Schneeschieb-Bär)
Beschrieben: DIRGIS 2019
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Die Tiere erreichen eine Länge von zwei bis zweieinhalb Metern und eine Schulterhöhe von 1,5 Metern. Männchen kommen auf ein Gewicht von bis zu 700 Kilogramm. Rekordhalter ist ein Männchen mit einem Gewicht von 916 Kilogramm aus Misty Range. Das sehr dichte Fell ist schneeweiß bis Elfenbein oder gelbweiß und ermöglicht dem Tier eine gute Tarnung. Die Haare sind nicht hohl, weshalb der Schneeschiebbär nur eine geringe Wärmeisolation besitzt und mit besonders niedrigen Temperaturen Probleme bekommt. Grund für diese mangelnde Anpassung an seinen schneereichen Lebensraum ist der Umstand, dass der Schneeschieb-Bär ursprünglich eine Art der seichten Sandstrände gewesen ist, als Misty Range noch eine gemäßigte Lagune darstellte. Über die Millionen von Jahren verschwand die Lagunenlandschaft und die Temperaturen sanken, der Schneeschieb-Bär blieb, passte sich aber bisher nur geringfügig an den neuen Lebensraum an. Die Hinterfüße sind verbreitert und formen als Paar eine Schaufel. Mit dieser Schaufel werden Eis- und Schneemassen verschoben und aufgeschichtet. Diese Schaufelfüße besitzen Fell und eine verdickte Horn- und Lederhaut mit fast schon metallenem Charakter, bei den Schneeschieb-Bären aus der Zeit der Lagune, schienen sie als Flossen fungiert zu haben.
Lebensraum
Der Schneeschieb-Bär besiedelt die Schneereichen Regionen Belletristicas, dort ist er selbst in höheren Lagen anzutreffen. Trotz seiner Größe, gilt er in manchen Gebieten als ein Kulturfolger.
Lebensweise
Ernährung
Schneeschieb-Bären sind Allesfresser. Sie fressen bodennahe Pflanzen, aber auch Fleisch und Fisch. Dabei wird ein großteil der Nahrung erbeutet, während der Schneeschieb-Bär seine Schneeverschiebungen betreibt und so Wühlmausbauten freigelegt werden. Auch Aas verschmähen sie nicht, die Mägen der Schneeschieb-Bären sind gegen fauliges Fleisch immun, was aber nur selten von Notwendigkeit geprägt ist, da in der eisigen Umgebung Nahrung meist noch Wochen lang frisch ist.
Verhalten
Schneeschieb-Bären leben für sich einzeln, können in der Nähe größerer Nahrungsvorkommen aber auch in größeren Ansammlungen anzutreffen seien. Diese Gruppierungen sind allerdings lose und verlieren sich sofort, wenn das Nahrungsangebot nachlässt oder der Schneefall sie auseinander treibt. Der Schneeschieb-Bär ist vor allem in den frühen Morgen- und Vormittagsstunden zu hören, wenn er mit seinen Pranken über das Eis krazt und beim Verschieben von Schneemassen einen ordentlichen Radau verursacht. Es wird angenommen, dass diese lautstarken Schneeverschiebungen der Reviermarkierung dienen, da die Revieredurch Schneefall täglich neu gesteckt werden, hört man den Schneeschieb-Bären auch täglich aufs neue.
Die Nacht verbringt der Schneeschieb-Bär in einem selbst zusammengeschobenen Schneebau, welchen er mit seinen Füßen erst anhäuft, um ihn dann auszuhöhlen. Innerhalb dieser Schneehöhle wird es, aufgrund der Körperwärme des Bären, 10 bis 15 °C warm, was bei einer Umgebungstemperatur von teilweise - 50 °C ein enormer Temperaturunterschied ist, der Lebensrettend seien kann.
Fortpflanzung
Die Paarung erfolgt im Frühjahr, jedoch ruht die Entwicklung der befruchteten Eizelle bis in den Herbst. Hat die Bärin bis dahin ausreichend Fettreserven angelegt, schiebt sie sich eine große Höhle aus Eis- und Schnee zusammen, in der sie nicht nur überwintert, sondern auch die Jungtiere zur Welt bringt. Konnte das Weibchen im Sommer nicht genügend Nahrung finden, werden die Embryonen vom Körper resorbiert. Im Januar des Folgejahres werden dann nach acht Monaten Tragzeit ein bis drei Junge geboren, die bei der Geburt ein Gewicht von 200 Gramm und eine Körperlänge von 6 Zentimetern aufweisen. Das Wachstum ist aufgrund fettreicher Milch sehr schnell und so können die Jungtiere nach zwei Monaten bereits die Geburtshöhle erstmals verlassen, zu dieser Zeit wiegen sie fast 15 Kilogramm, was eine Gewichtszunahme von über 1,8 Kilogramm die Woche bedeutet.
Die Jungen werden zwei bis drei Jahre gesäugt. Während dieser Zeit lernen sie das Jagdverhalten der Mutter und werden schließlich von ihr verlassen. Schneeschieb-Bären werden mit etwa fünf bis sechs Jahren geschlechtsreif. In der Natur werden sie selten älter als 30, der älteste noch lebende Schneeschieb-Bär in Haltung ist bereits 53 Jahre alt.
Gefährdung
Seit die Jagd auf Schneeschieb-Bären gesetlich verboten ist, haben sich ihre Bestände auf geschätzte 20.000 bis 25.000 Tiere eingependelt. Hauptbedrohung für die Schneeschieb-Bären sind Angriffe von Winterdämonen und die steigende globale Erwärmung, welche dazu führen kann, dass ihre Schneebauten schmelzen und über ihnen zusammen stürzen. Insbesondere in der schutzlosen Winterruhe stellen diese Faktoren ein immenses Problem dar. In urbanen Gebieten kann der Schneeschieb-Bär als Plage empfunden werden, dabei sind seine Schneeverschiebungen in schneereichen Zeiten ein wahrer Segen, da sich so deutlich weniger Eisflächen bilden. Dennoch werden besonders auffällige Exemplare von der Savanto (einer Wildtierfang- und Rettungsinitiative des Biotopenparks) aus urbanen Gebieten entnommen und in andere Gebiete überführt. Die BCS stuft den Bestand der Schneeschieb-Bären derweil als gering gefährdet.
Kulturelle Bedeutung
Gefährlichkeit
Trotz seiner Größe ist der Schneeschieb-Bär eine der ungefährlicheren Bärenarten, Hauptgrund sind seine breiten Füße, welche ihn behäbig und langsam machen und einen Prankenschlag ebenfalls erschweren.
Systematik
-
Anmerkungen
-