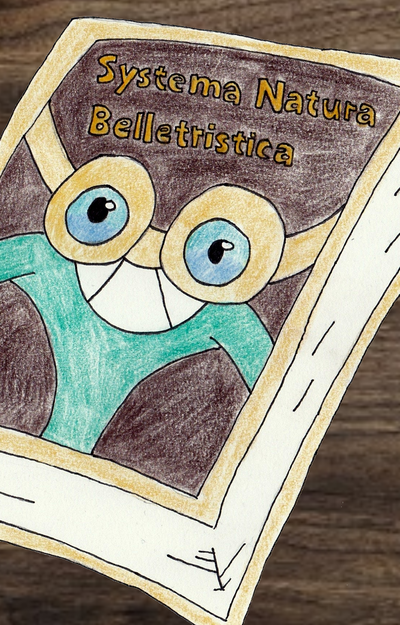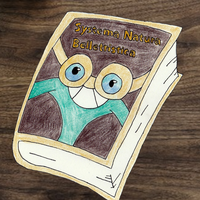Defintion des Registers
Die Blutmondorange (Citrus sanguluna) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Rautengewächse (Rutaceae). Ihre Früchte werden zu Vampirblut, einem exquisiten Fruchtwein vergoren und ist zeitgleich Hauptnahrungsquelle des Vampirmoti (Fructpotator vampire). Ihren Namen erhielt die Pflanze durch die Besonderheit, dass die besten Früchte immer in einer Blutmondnacht gepflückt werden.
Taxonomie
Reich: Pflanzen (Embryophyta)
Stamm: Gefäßpflanzen (Tracheophyta)
Unterstamm: Samenpflanzen (Spermatophytina)
Klasse: Bedecktsamer (Magnoliopsida)
Ordnung: Seifenbaumartige (Sapindales)
Familie: Rautengewächse (Rutaceae)
Gattung: Citrus
Spezies: Citrus sanguluna (Blutmondorange)
Beschrieben: FELIX 2018
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Blutmondorangenbäume sind mittelgroße bis große, sommergrüne Bäume mit Wuchshöhen zwischen 10 und 20 Metern. Die runden Baumkronen weisen eine regelmäßige Verzweigung auf. Die jungen Zweige sind kantig und mit dünnen, biegsamen, eher stumpfen, bis zu 10 Zentimeter langen Dornen besetzt.
Die wechselständig und spiralig an den Zweigen angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist verkehrt-eiförmig, geflügelt, mit schmaler Basis, 2 bis 4 Zentimeter breit und 0,8 bis 1,8 Zentimeter lang. Die ledrige, dicke, dunkelgrüne Blattspreite ist deutlich vom Blattstiel abgesetzt, mit abgerundetem Blattgrund, oval und zugespitzt.
Die Keimblätter (Cotyledonen) sind blutrot.
Blüten
Die Blüten stehen einzeln in den Blattachseln oder in wenigblütigen, traubigen Blütenständen zusammen. Die duftenden Blüten sind radiärsymmetrisch und zwittrig. Die vier oder fünf Kelchblätter sind verwachsen. Die fünf freien Kronblätter sind kamesinrot gefärbt. Es sind 20 bis 25 Staubblätter vorhanden, deren Staubfäden an ihrer Basis zu mehreren Gruppen verwachsen sind. Der Fruchtknoten ist oval und deutlich vom Griffel abgesetzt. In Belletristica blüht die Blutorange von Februar bis Juni.
Auch ohne eine Bestäubung können diese Bäume Früchte ausbilden, eine Eigenschaft, welche sich bei vielen Zitrusfrüchten findet.
Im Inneren und mit der Schale verbunden befindet sich ein poröses weißes Gewebe, das weiße, bittere Mesokarp. Die Blutmondorange enthält in ihrem Inneren mehrere verschiedene Fruchtblätter, normalerweise etwa dreizehn, jedes durch eine Membran abgegrenzt und enthält viele saftgefüllte Bläschen und normalerweise einige Kerne. Unreife Fruchtblätter sind grün und färben sich mit der Reife dunkelrot. Die körnige, unregelmäßige Schale der reifen Frucht kann von leuchtend rotorange bis blutrot reichen. In der reifen Fruchtschale sitzen zahlreiche Öldrüsen, sie verströmen einen aromatischen Duft. Schale und Segmente sind miteinander verwachsen, die Frucht lässt sich nur schwer schälen oder teilen. Die zentrale Achse der Frucht ist hohl und mit dunkelrotem, zähen Saft gefüllt. Jede Frucht enthält einige Samen. Die großen, ovalen Samen besitzen eine raue Samenschale und ein weißes Inneres. Jeder Samen enthält einen bis meist viele Embryonen unterschiedlicher Größe.
Qualitätsmerkmal der Früchte
Eigentlich sind Blutorangen immer essbar, sobald sie einen Durchmesser von 4 Zentimetern erreicht haben. Sollten die Blüten bei einem Blutmond bestäubt sein und die Früchte zu Neumond geerntet werden, bleibt die Farbe der Schale gleich, aber die Früchte werden kernlos. Wird die Blüte zu Neumond bestäubt, aber bei einem Blutmond gepflückt, wird die Blutmondorange sehr saftig und von besonderem Geschmack sein. Dies ist aber nicht direkt nachdem pflücken der Fall, sonder 13 Tage nachdem Blutmond. Zu diesem Tag wird sich die Schale Tiefschwarz verfärbt haben und die Frucht großteilig mit vollrotem, saftigen Fruchtfleisch ausgestattet sein.
Lebensraum & Ökologie
Lebensraum
Die Blutmondorange stammt ursprünglich aus Adventuria und Origin. Die Art hat sich über Jahrhunderte, meist als Proviant in Kriegen, über ganz Belletristica verteilt. Ein Großteil dieser Bestände ist heute nicht mehr existent, die Art findet sich vermehrt in Blut- und Vampirregionen. Das Krea-Tief-Tal und andere Wüsten werden gemieden, der Baum besiedelt hauptsächlich Sonnenabgewandte Hänge und zieht kühle Temperaturen, wärmeren Gefilden vor. Er gedeiht aber auch in tropischen und subtropischen Regionen, meistens sind hier die Erträge süßer, aber weniger zahlreich.
Ökologie
Die Blutmondorange wird hauptsächlich durch den Vampirmoti verbreitet. Welcher die Früchte mit seinen Spitzenzähnen durch die Schale hindurch aussaugt. So entstehen die vielerorts gesehen Sichelförmigen Früchte, welches fast vollständig ausgesaugt sind. Sollte eine der beiden Arten verschwinden, wird auch die andere Art von Belletristica verschwinden.
Kulturelle Bedeutung
Nutzung
Schwarzschalige Blutmondorangen werden nach ihrer dreizehntägigen Fermentierung hauptsächlich edlem Fruchtwein verarbeitet, welcher als Vampirblut bezeichnet wird. Die allgemeine Bezeichnung für die verschiedenen Vampirblutweine sind Blutweine.
Neben der Weinverarbeitung, werden kernige Früchte entweder als Obst oder als Saatgut für eine neue Generation genutzt. Auch als Zierbaum erfreut sich die die Blutmondorange großer Beliebtheit.
Weinherstellung
Blutsuppen
In der Weinherstellung durch Trauben spricht man von einer Maische, diese besteht aus: Fruchtfleisch, Traubenkernen, Schalen und Saft. Da in einer schwarzschaligen Blutmondorange keine Kerne vorliegen, entschied man sich diesen Teilabschnitt der Blutweinherstellung als Blutsuppen zu bezeichnen.
Die Blutmondorangen werden in einer Mühle zerdrückt, so dass ein dickflüssiges Gemisch aus Fruchtfleisch, Schalen und Saft entsteht. Dieses Gemisch wird für einige Stunden sich selbst überlassen, um unter anderem Aromavorstufen, Geschmacksstoffe, Phenole und weitere lösliche Substanzen aus den Orangen in den Saft zu extrahieren. Durch diese Standzeit werden Stoffe gelöst, welche das Grundaroma des Weines ausmachen werden. Zudem erleichtert man sich so den Arbeitsaufwand beim späteren Pressen. Da im Gemisch nach 3 bis 5 Stunden Enzyme freigesetzt werden, welche die Schale aufweichen.
Kälterung
In einer Weinpresse (auch Kelter) wird das Gemisch ausgepresst. So werden die harten Schalen- und Fruchtfleischrückstände vom süßen Fruchtsaft (Most) getrennt. Aus ungefähr 150 Kilogramm Blutmondorangen gewinnt man ungefähr 70 bis 90 Liter Most. Eine besonders schonende Pressung ist wichtig, damit keine Bitterstoffe in den Wein gelangen, welche sich in der Schale befinden.
Die nach dem Pressen in der Weinpresse zurück gebliebenen festen Bestandteile der Orangen (Schale und Stiele) bezeichnet man als Blutlachen. Diese Blutlachen können nochmals aufgegossen werden und werden als bittersüßer und teils stark vergorener Blutsud vertrieben.
Die Blutlache eignet sich ebenso als kurzlebiger Dünger, denn auch bei ihr setzt die Gärung sehr schnell ein.
Entzug von Sauerstoff
Dem gewonnenen Most wird anschließend Schwefel beigemischt. Dies geschieht, indem Schweflige Säure oder Schwefeldioxid in den Most geleitet wird. Die Schwefelung soll zum einen die Oxidation des Weines verhindern, das heißt oxidationsempfindliche Inhaltsstoffe schützen, eine enzymatische Aufhellung verhindern bzw. eine Verdunklung des Most zu schwarzer Farbe herbeiführen (desto mehr Sauerstoff im Fruchtfleisch der Blutmondorange enthalten ist, desto heller ist sie). Zum anderen vor einem mikrobakteriellen Verderben schützen.
Die richtige Dosierung der Zusätze ist für den Verlauf der Gärung und Reifung von immenser Bedeutung und damit auch entscheidend für die Weinqualität. Fertig ausgebaute Blutweine sollten etwa 40 Milligramm Schwefeldioxid pro Liter enthalten. Eine Überdosierung ist nicht unproblematisch, da stark geschwefelte Weine zum einen zu Unbekömmlichkeit führen können mit Anzeichen wie Kopfschmerz und Magen- und Verdauungsbeschwerden und zum anderen eine Überschwefelung eine störende Schwefelgeruchnote verursachen oder in höheren Konzentrationen auch direkt den Geschmack des Weins beeinträchtigen kann.
Gärung
Anschließend findet die Gärung statt. Sie verläuft in, mit Gärverschlüssen wie dem Gärröhrchen abgedichteten, Holzfässern. Durch die Zugabe von speziellen Hefen wird die Gärung beschleunigt.
Die Hauptgärung dauert um die fünf bis dreizehn Tage. In dieser Zeit wird der im Most enthaltene Zucker zu Alkohol umgesetzt. Während der Gärung kann sich die Flüssigkeit auf eine Temperatur bis zu 35 °C erwärmen. Dies hat zur Folge, dass sich die Hefen schneller vermehren und der Wein schneller durchgärt. Dies könnte sich aber wieder auf den Geschmack des Weines auswirken, da gewisse Inhaltstoffe nicht Wärmeresistent sind, weshalb die Temperatur vom Winzer kontrolliert wird. Die meisten Winzer vergären den Wein bei 15 bis 18 °C. Je länger die Gärung dauert, desto frischer und schlanker wirkt der Wein. Dies ist auf die Gerb- und Aromastoffe, die Träger der Geschmacksstoffe, zurückzuführen, die bei kürzeren Gärzeiten weniger abgebaut wurden und so in größerer Zahl vorhanden sind.
Nach dem Gärvorgang erreichen die meisten Blutweine zwischen 8 und 13 Volumenprozent Alkohol; es gibt Ausnahmen, bis zu 23 Prozent Alkohol lassen sich durch Gärung mit bestimmten Hefestämmen erreichen. Außer Alkohol entstehen noch ungefähr 500 andere Verbindungen, die Einfluss auf den Geruch und den Geschmack des Weines haben. Wenn der Most komplett durchgegoren wird, erhält man "trockenen" Wein. Wird die Gärung vorzeitig unterbrochen (Gärunterbrechung), erhält man je nach Menge des unvergorenen Restzuckers "halbtrockenen", "lieblichen" oder "süßen" Wein. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die Gärung auch von alleine ins Stocken geraten. Diesen Prozess können Winzer in den nördlichen Grenzlagen oftmals recht einfach steuern, indem sie eine Kellertüre nach draußen bei kalter Witterung öffnen.
Abstich
Etwa gegen Ende Dezember ist im Raum Belletristicas die Gärung in der Regel abgeschlossen. Die nun abgestorbenen Hefen sinken langsam zu Boden.
Nun wird abgestochen, das bedeutet, die am Boden des Gebindes abgelagerte Hefe (Geläger) wird entfernt und der Wein wird in andere Gebinde umgelagert. Meistens wird der Wein dabei von oben abgesaugt. Die zurückbleibende Hefe kann ausgepresst und der entstehende Hefewein zu Hefebrand gebrannt werden.
Reifung
Der Jungwein ruht nun die nächsten vier bis sieben Monate in Holzfässern. In dieser Zeit gärt die Feinhefe, also Schwebeteile der Hefe, die nicht abgesunken sind, nach und baut dabei noch im Wein enthaltene Eiweiße ab. Die Salze der Weinsäure (Weinstein) lagern sich zu dieser Zeit an Boden und Wänden des Gebindes ab. Der Jungwein ist zwar schon trinkbar, aber es folgen, je nach Erfordernis, weitere Umfüllungen, Filtrationen und weitere Nachbehandlungen.
In dieser Zeit übernimmt der Wein einige Geschmacks- und Farbstoffe des Holzes in dem er gelagert wird. Häufig wird für die Fässer importiertes Blutbuchenholz verwendet.
Eine wichtige Rolle spielt auch das Alter des Fasses, wie oft es also schon in Gebrauch war. Bei neuen Fässern ist der Holzton oft sehr dominant, und der Weingeschmack tritt in den Hintergrund. Bei zu alten Fässern wirkt der Wein manchmal muffig und abgestanden. Die besten Ergebnisse erzielen viele Winzer durch den Ausbau in alten und neuen Fässern und das spätere Verschneiden (ungefähr 1:1 Mischung aus beiden Fasstypen) der Inhalte.
Lagerung
Die meisten Blutweine können bis zu vier Jahre gelagert werden, ohne starken negativen Veränderungen ausgesetzt zu sein. Manche Blutweine – vor allem auch Süßblutweine – können 100 bis 200, einzelne sogar über 2000 Jahre überstehen und immer noch trinkbar sein, wie am Tag ihrer Fertigstellung.
Entscheidend für die längerfristige Lagerfähigkeit sind mehrere Faktoren. Blutwein sollte im Allgemeinen lichtgeschützt, bei mäßigen, konstanten Temperaturen ("Grufttemperatur") und zum Schutz vor Oxidation durch Reduktion unter weitgehendem Luftabschluss gelagert werden. Dies kann entweder in spundvollen Fässern geschehen oder auch in Flaschen, wobei Flaschen liegend zu lagern sind, um den Korken feucht zu halten, da ein austrocknender Korken mit der Zeit zunehmend luftdurchlässig wird. Bevor die Flaschen oder Fässer mit dem Wein befüllt werden, wird ihnen über eine Vakuumpumpe sämtlicher Sauerstoff entzogen, sodass der Blutwein "geronnen" ist, also von schwarzer Farbe. Diese schwarze Farbe verliert der Wein erst, wenn er in ein Glas gefüllt wird und für etwa 3 bis 5 Minuten steht, und sich wieder in eine blutrote Flüssigkeit verwandelt.
Geschmack
Geschmacklich varriert der Wein aus Blutmondorangen von fruchtigsüß bis fruchtigbitter, allen Sorten gemein ist eine leichte metallene Note, die an Blut erinnert.
Weinkeller
Wer gefallen an den Blutweinen findet, sollte über einen Weinkeller nachdenken, da hier die Lagerung der edlen Tropfen am besten gelingt. Weinkeller mit größeren Sammlungen verschiedenster Jahrgänge finden sich im Schloss der Schatten, sowie im Biotopenhaus.
Systematik
-
Anmerkungen
-