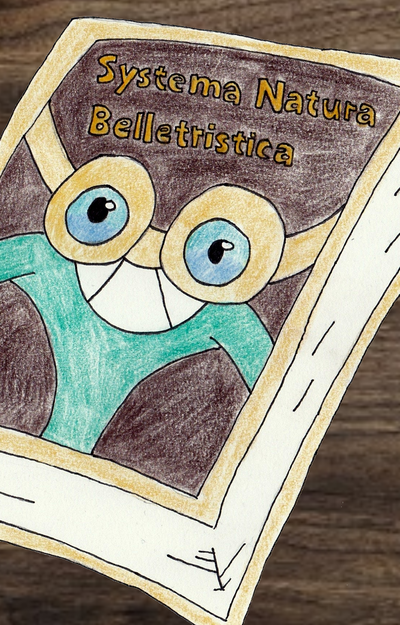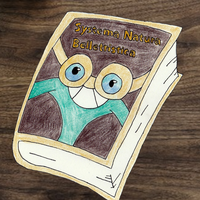Definition des Registers
Die Zeitungsente (Anas tatars), auch als Tatarenente bezeichnet, ist ein Vogel der häufig in der Welt der Worte zu finden ist, so auch auf dem Kontinent Belletristica - hier meist als Zugvogel.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Sauropsida (Sauropsida)
Klasse: Reptilien (Reptilia)
Ohne Rang: Eureptilien (Eureptilia)
Ohne Rang: Diapsida
Ohne Rang: Archosauromorpha
Ohne Rang: Archosauriformes
Ohne Rang: Crurotarsi
Ohne Rang: Archosauria
Ohne Rang: Avemetatarsalia
Ohne Rang: Dinosauromorpha
Ohne Rang: Dinosaurier (Dinosauria)
Ohne Rang: Echsenbeckensaurier (Saurischia)
Ohne Rang: Theropda
Unterklasse: Vögel (Aves)
Teilklasse: Neukiefervögel (Neognathae)
Überordnung: Galloanserae
Ordnung: Gänsevögel (Anseriformes)
Unterordnung: Anseres
Überfamilie: Anatoidea
Familie: Entenvögel (Anatidae)
Unterfamilie: Anatinae
Tribus: Schwimmenten (Anatini)
Gattung: Anas
Spezies: Anas tatars
Beschrieben: Felix 2017
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Zeitungsenten werden von 20 Zentimetern bis zu 65 Zentimeter lang, ihre Flügelspannweite beträgt bis zu einem Meter. Das Männchen trägt im Zeitraum zwischen Juli und August sein Schlichtkleid (sog. "Saure Gurkenzeit") und sieht dabei dem Weibchen zum Verwechseln ähnlich. Lediglich anhand der Schnabelfärbung lässt sich in dieser Zeit das Geschlecht bestimmen, denn der Schnabel des Männchens ist weiterhin deutlich tintenblau, wogegen der Schnabel des Weibchens dunkelgrau bis schwarz ist. Das Weibchen hat eine weiß-grau gesprenkelte Färbung, wodurch die Tiere an Land gut getarnt sind. Die Sprenkel des Federkleides wirken wie aus der Distanz betrachtete Buchstaben und Sätzen, was an eine Zeitung erinnert. Das einzig Auffällige ist der tintenblaue Flügelspiegel, der dem des Männchens entspricht, der im Jägerlatein als "Tintenfleck" bezeichnet wird. Im Flug wird bei beiden Geschlechtern die weiße Umrandung des blauen Flügelspiegels sichtbar. Männchen sind von Dezember bis Juni im sog. Brisantgefieder anzutreffen, dabei färben sich Kopf und Rücken gut sichtbar bunt, während die restlichen Körperteile dem Schichtgefieder ähneln. Zuweilen kommt es zur sog. Bildfleckenbildung, sodass die Schlichtfärbung an manchen Stellen durch buntes Gefieder durchbrochen wird.
Zeitungsenten haben etwa 10.000 Daunen und Deckfedern, die sie vor Nässe und Kälte schützen. Sie fetten dieses Federkleid immer ein, so dass kein Wasser durch das Gefieder dringt. Die Bürzeldrüse an der Schwanzwurzel liefert das Fett. Die Ente nimmt das Fett mit dem Schnabel auf und streicht es damit ins Gefieder. Auf dem Wasser wird die Ente von einem heißen Luftpolster getragen. Die heiße Luft hält sich zwischen dem Daunengefieder, und die Deckfedern schließen die Daunen ab. Zusammen mit dem Fettpolster unter der Haut verhindert die eingeschlossene heiße Luftschicht, dass Körperwärme verloren geht und die Ente auskühlt.
Mauser
Bei belletristicanischen Zeitungsenten wechseln die Erpel zu Beginn der praenuptialen Mauser (Diese vorbrutzeitliche Mauser ist in Europa auch bei vielen Singvögeln verbreitet und findet häufig im Winterquartier statt.) im Zeitraum zwischen Juli und August zunächst das Schwingengefieder und sind dann für drei bis fünf Wochen flugunfähig. Gleichzeitig erfolgt der Wechsel des übrigen Gefieders. Erst im Dezember ist die anschließende Entwicklung des Prachtkleides abgeschlossen. Die postnuptiale Mauser [Mauser der adulten Vögel nach der Brutzeit, sie ist häufig als Vollmauser ausgeprägt und in Europa ebenfalls bei vielen Singvögelnverbreitet.] beginnt bei Zeitungsentenerpeln bereits Mitte Mai mit dem Abwurf der mittleren Steuerfedern, während die Weibchen noch brüten. Es folgt darauf dann die Mauser des Kleingefieders. Bei Weibchen findet die Mauser der Schwingen im September statt und der Wechsel des Kleingefieders in Brutkleid im Zeitraum zwischen Oktober und November.
Stimme
Die Zeitungsente ist eine sehr ruffreudige Ente und wird von Jägern daher auch als "Meldevogel" bezeichnet. Da es sich um einen sehr wachsamen Vogel handelt, werden meist viele Tiere durch seinen frühen Ruf vor Jägern und ähnlichem gewarnt.
Männchen und Weibchen besitzen unterschiedliche Rufe. Für die Erpel ist ein gedämpftes „ka[u]f“ charakteristisch, das sie gelegentlich auch gereiht mit einem schnaufen als „Kaa[u]f-nnn-nnn; Kaa[u]f-nnn-nnn“ mit abfallender Tonhöhe und Lautstärke hören lassen. Bei den Weibchen gibt es ähnliche Rufreihe, die jedoch eher nach „Les-nn Les-nnn Lesnn“ klingt.
Zum Lautrepertoire der Zeitungsente zählen auch einige Instrumentallaute. Dazu zählt das „wich wich wich …“, das für den Flug charakteristisch ist, mit den Flügeln erzeugt wird und an das Blättern von Seiten erinnert.
Balzlaute
Eine Reihe von Rufen sind mit der Balz verbunden. Dazu zählt der charakteristische Grunzpfiff der Männchen, der lautmalerisch mit „gerijib“ oder „fihb“ umschrieben wird. Er erklingt besonders häufig, wenn die Erpel während der Balz die Schnäbel eintauchen und anschließend Kopf und Körper hochreißen.
Während der Balz kommt es außerdem zu einem ritualisierten Scheinputzen der Männchen, bei dem sie mit dem Schnabel von hinten her die Kiele der Handschwingen berühren. Das erzeugt ein ratterndes „rrp“-Geräusch.
Lebensraum
Die Zeitungsente ist weltweit zu finden und besiedelt jede Sparte eines jeden Lebensraums. Dabei ist sie häufig in Gewässernähe zu finden. Zeitungsenten wurden bis in eine Höhe von 5100 Metern über dem Meeresspiegel nachgewiesen.
Es findet ein Prozess der Verstädterung statt, der schon sehr lange anhält. Stadtenten besiedeln Gewässer im Bereich von Städten, besonders Teiche und Weiher in Parks, aber auch Flüsse, die die Städte durchfließen und andere natürliche Gewässer, wie etwa Seen, im Bereich von Städten. Da diese Vögel zuweilen auch an Kopf und Rücken grünlich gefärbt seien können, führen sie häufig zu Pseudokrokoilsichtungen und ähnlichem. Selbst größere Brunnen werden von der Zeitungsente besiedelt. Zeitungsenten sind aufgrund ihrer anspruchslosen Wahl bezüglich ihres Nistplatzes und ihrer omnivoren Lebensweise prädestiniert für eine Verstädterung. Im städtischen Raum wählen Zeitungsenten Neststandorte, die aus menschlicher Sicht häufig ausgefallen wirken. Dazu zählen Nester vor allem Nester in und um Kiosken, aber auch Bibliotheken.
Lebensweise
Ernährung
Die Zeitungsente ist in Bezug auf die bevorzugte Nahrung anspruchslos, sie ist eine ausgesprochen omnivore Art, die alles frisst, was sie hinreichend verdauen und ohne großen Aufwand erlangen kann. Neue Nahrungsquellen werden von dieser Art schnell erkannt und ohne Wartezeit genutzt. Mögliche Fehleinschätzungen mit eingeschlossen.
Die Nahrung der Zeitungsente besteht überwiegend aus pflanzlichen Stoffen, in der Regel mit erhöhtem Gehalt von Cellulose. Sie bevorzugt dabei besonders Samen, Früchte, grüne Wasser-, Ufer- und Landpflanzen. Zum Nahrungsspektrum gehören aber auch aller Hand Kleintiere ihres Ökosystems, wie Weichtiere, Larven, kleine Krebse, Kaulquappen, Laich, kleine Fische, Frösche, Würmer und Schnecken.
Die Nahrungszusammensetzung unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen. Belletristicanische Zeitungsenten leben zu Beginn und während der Brutzeit fast nur von pflanzlicher Nahrung. Dabei werden zunächst Samen und überwinternde Grünteile und später das frisch sprießende Grün bevorzugt gefressen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Küken schlüpfen, finden diese nicht nur eine mittlerweile reichlich vorhandene pflanzliche Nahrung vor, sondern auch reichliche tierische Nahrung in Form von Insekten und deren Larven, welche sie für ihr Wachstum und die Federentwicklung brauchen. Junge Zeitungsenten, die viel tierisches Protein vorfinden, weisen eine deutlich größere Wuchsrate auf als die, die sich überwiegend pflanzlich ernähren.
Im Juli und August ernähren sich Zeitungsenten fast ausschließlich von der Sommergurke (Uvam cucumeris).
Sobald die Jungen flügge sind, suchen die Zeitungsenten zunehmend auch auf Feldern nach Nahrung. Dabei werden besonders gerne die noch nicht ausgereiften Körner von Getreiden gefressen. Im Herbst fressen Zeitungsenten auch Eicheln und andere Nüsse. Auch Kartoffeln werden von ihnen als Nahrungspflanze angenommen. An Futterstellen frisst die Zeitungsente auch gelegentlich Brot und Küchenabfälle. Obwohl sie in ihrer Ernährung grundsätzlich sehr anpassungsfähig ist, frisst sie keine salzliebenden Pflanzen, da sie die Salze nicht einfach wieder ausscheiden können. An Küsten lebende Zeitungsenten fressen beispielsweise fast ausschließlich Meeresweichtiere.
Bei der Nahrungssuche unter der Wasseroberfläche tauchen die Zeitungsenten mit dem Kopf ab, schlagen mit den Flügeln auf die Wasseroberfläche und kippen dann vornüber. Diese für Zeitungsenten charakteristische Haltung mit senkrecht aus dem Wasser ragendem Bürzel wird als gründeln bezeichnet. Dabei suchen sie den unter ihnen liegenden Gewässerboden nach Fressbarem bis zu einer Tiefe von etwa einem Meter ab. Mit ihrem Schnabel beißen sie Pflanzenteile ab und drücken das Wasser, das sie auch aufgenommen haben, durch die Hornleisten des Schnabels nach draußen. Diese Teile des Schnabels wirken wie ein Sieb, in welchem die Nahrung hängen bleibt.
Verhalten
Fortpflanzung
Die Standvögel unter den Zeitungsenten verpaaren sich in der Regel bereits im Herbst, während die Paarbildung der Zugvögel überwiegend erst im Frühjahr stattfindet. Unter den Zugvögeln sind es meist die älteren Weibchen, die zuerst ihr Brutareal aufsuchen. Bei den meisten Populationen besteht außerdem ein Überhang an Männchen. Dies führt dazu, dass Zeitungsenten während der Paarungszeit sehr unruhig sind und durch die häufigen Reihflüge und Meldungsrufe auffallen.
Kennzeichnend für Zeitungsenten ist eine ausgedehnte Gemeinschaftsbalz mehrerer Erpel, diese Werbung findet kurz nachdem die Erpel im Frühherbst ihr Prachtkleid angelegt haben. Diese Form der Balz hat keine Bedeutung im Sinne eines Begattungsvorspiels, sondern trägt zur Gruppenbildung artgleicher Tiere bei, die dann die Paarbildung erleichtert.
Bei der Gesellschaftsbalz plustern Zeitungsentenerpel das Bauch- und Seitengefieder auf und heben die Flügel leicht an. Sie zeigen in dieser Phase ein typisches Bewegungsmuster, bei dem bei gesträubten Kopffedern zuerst die Schwanzfedern kräftig geschüttelt, danach der Kopf tief eingezogen und dann kräftig nach oben geschnellt wird. Dabei entsteht ein charakteristisches Geräusch, welches an das Rascheln von Papier erinnert. Hierauf sinkt der Erpel, während er erneut das Schwanzgefieder kräftig schüttelt, wieder zusammen, auch hier entsteht das Geräusch von neuem. Dem folgen auffällige, mehrfach wiederholte Bewegungsmuster bei dem die Zeitungsente das Rascheln mit ihrem Meldungsruf ergänzt. Dabei ist zu beobachten, dass die raschelenden Bewegungen immer dem Ruf folgen und nicht umgekehrt.
Nach dieser Gemeinschaftsbalz mehrerer Erpel verpaaren sich Zeitungsenten erstmals locker. Nach der Verlobungszeit, die neben dem sog. „Antrinken“ und dem Vertreiben anderer Erpel vor allem am Hintereinander- und Nebeneinanderherschwimmen beobachtet werden kann, findet die jährliche Partnersuche, die sog. Reihzeit, im Januar bis Anfang Februar statt. Reihzeit heißt die Balz, weil sich mehrere Erpel hinter den wenigen Weibchen „einreihen“. Diese Einreihung führt auch zu Reihflügen in dem mehrere Erpel einem Weibchen hinterher fliegen.
Zeitungsenten verfügen zwar über ein umfangreiches Balzrepertoire, im Wettkampf der Erpel um die Weibchen wird dieses jedoch häufig nicht gezeigt. Häufig werden Weibchen von mehreren Männchen begattet, ohne dass das übliche Balzzeremoniell vorangeht. Es sind zahlreiche Fälle dokumentiert, bei denen das Weibchen von übereifrigen Männchen ertränkt wurde.
Gemeinsam suchen die Paare einen Nistplatz, der an einer Uferböschung, aber manchmal auch bis zu zwei, drei Kilometer vom Wasser entfernt liegen kann. Zeitungsenten sind bei der Wahl des Neststandortes ausgesprochen vielseitig. Bei dem Versuch, Gemeinsamkeiten in der Nistwahl zu finden, sind bisher alle gescheitert. Die einzige Gemeinsamkeit die es zu geben scheint, ist wohl die Tatsache, dass sich Zeitungsenten der Umgebung in ihrer Nistwahl anpassen. In Niederungsgebieten finden sich die Nester überwiegend im Grünland, an Seen mit ausgeprägten Vegetationsgürteln in der Ufervegetation, an Waldseen im Wald und in Städten zuweilen in Häusern. Im Überschwemmungsgebieten bauen Zeitungsenten ihre Nester überwiegend in Bäumen. In Wäldern brüten sie bevorzugt an Baumstümpfen, sie nehmen aber auch Baumhöhlen an und brüten auch in alten Nestern anderer Vögel.
Das Nest selbst ist eine einfache, flache Mulde, die vom Weibchen in den Untergrund gedrückt und mit groben Halmen ausgepolstert wird. In Städten finden sich hierbei auch andere Nistmaterialien wie Verpackungen und Papierschnipsel. Nach dem Nestbau, mit dem Eintreten der Brut, verlässt der Erpel die Ente ‒ eine Verhaltensweise, die wahrscheinlich sich als Anpassung an seine auffällige Gefiederfärbung ergeben hat.
Die Weibchen brüten einmal im Jahr ein Gelege von 7 bis 16 Eiern 20 bis 30 Tage lang aus, wobei sie ab März täglich jeweils ein Ei legen. Bleiben die ersten vier offen zurückgelassenen Eier von Gelegeräubern unbeeinträchtigt, so legt die Ente weiter in dieses Nest und deckt die Eier beim kurzzeitigen Verlassen des Nestes nun ab. Drei Tage vor dem Schlüpfen beginnt das Küken zu piepen. Mit dem Eizahn (einem spitzen Zahn am Schnabelende) bohrt das Küken ein Loch in die Kalkschale des Eies und strampelt sich aus dieser heraus, danach bleibt es vorerst erschöpft liegen. Enten werden als Nestflüchter bezeichnet, das heißt, sie sind beim Schlüpfen bereits sehr weit entwickelt, verlassen nach sechs bis zwölf Stunden das Nest und können von Anfang an schwimmen. In den ersten Stunden ihres Lebens laufen sie demjenigen nach, den sie zuerst erblicken. Das ist im Regelfall die Mutter. Diese Form der Interaktion von Lernen und angeborenem Verhalten heißt Prägung und ist bei Nestflüchtern ein entscheidender Bestandteil des Fortpflanzungszyklus.
Nach acht Wochen können die Jungenten fliegen. Etwa 50 bis 60 Tage lang bleibt die Ente auch noch mit den flüggen Küken in einer Kolumne -einer Enten-Gelegefamilie- zusammen.
Ökologie
Prädatoren
Die Prädatoren der Zeitungsente sind und anderem die Satiere (Sermoingenium pleaserisum), welche die Zeitungsenten bevorzugt fressen und zuweilen in der Luft zerreisen können.
Gefährdung
Die Zeitungsente ist in all ihren Verbreitungsgebieten annähernd häufig, auf dem Kontinent Belletristica ist sie eher selten, aber auch in keinster Weise bedroht oder gefährdet. Die Population unterliegt Schwankungen und ist in der Regel Ende März und Anfang April am größten. Die BCS betrachtet den Bestand in Belletristica als gering gefährdet. Eine Haltung und Nachzucht erfolgt im Biotopenpark.
Kulturelle Bedeutung
Kulinarische Bedeutung
Richtig zubereitet schält sich das Fleisch hauchdünn vom Knochen. Allerdings ist die Zubereitung dieser Delikatesse als allgemein schwierig bekannt und häufig endet man mit dickeren Fleischstücken, die so zäh wie Pappe sind.
Psychologisches
Die Tataraanatidaephobie ist die Angst von Zeitungsenten beobachtet zu werden.
Schadwirkung
Zeitungsenten können einen gewissen Schaden bei Kiosken und Bibliotheken verursachen, da sie während der Brutzeit sich auch hier an den Papiervorkommen bedient. Meist werden aber nur Zeitungen und Bücher auserkoren, die achtlos auf dem Boden liegen.
Jäger können dem Vogel nicht besonders viel abverlangen, da er ihre Jagdturen regelmäßig durch seinen Meldungsruf sabotiert.
Systematik
-
Anmerkungen
-