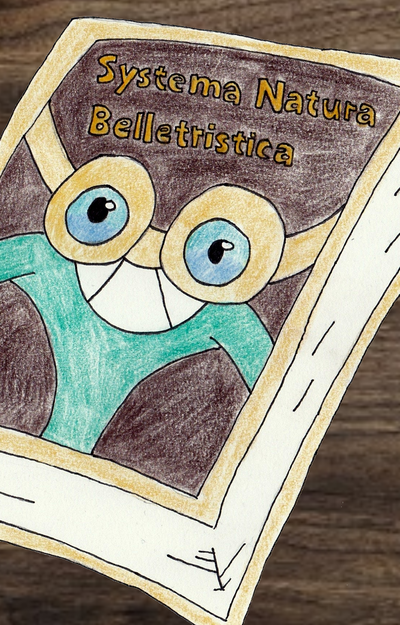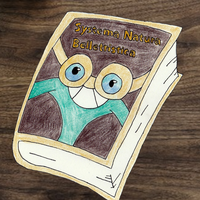Definition des Registers
Die Satiere (Sermoingenium pleaserisum zu dt. "Wortwitz bittelachen") ist eine Hyänenart des Kontinents Belletristica.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Synapsiden (Synapsida)
Ohne Rang: Theria
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria)
Überordnung: Laurasiatheria
Ordnung: Raubtiere (Carnivora)
Unterordnung: Katzenartige (Feliformia)
Teilordnung:: Viverroidea
Überfamilie: Herpestoidea
Familie: Hyänen (Hyaenidae)
Unterfamilie: Eigentliche Hyänen (Hyaeninae)
Gattung: Sermoingenium
Spezies: Sermoingenium pleaserisum (Satiere)
Beschrieben: FELIX 2017
Unterart(en): Bisher keine bekannt
Merkmale
Satieren erreichen eine Kopfrumpflänge von 110 bis 176 Zentimetern, der Schwanz ist mit 11 bis 33 Zentimetern recht kurz. Die Schulterhöhe beträgt 66 bis 99 Zentimeter. Das Gewicht liegt üblicherweise bei 22 bis 66 Kilogramm, einzelne Tiere können bis zu 99 Kilogramm wiegen. Weibchen und Männchen unterscheiden sich nur geringfügig voneinander und nicht in allen Körpermaβen.
Das Fell ist relativ kurz und rau, und die lange Rückenmähne ist bei der Satiere weniger ausgeprägt als bei den anderen Hyänenarten. Die relativ feinen, aber sehr dichten Wollhaare sind 11 bis 22 Millimeter lang, die gröberen und noch dichteren Deckhaare 33 bis 44 Millimeter. Die Grundfärbung des Fells ist am Rücken grau, während die Flanken dunkel mit weißen Flankenstreifen sind. Diese werden mit zunehmendem Alter bräunlicher oder können verblassen. Der Kopf ist dunkel schwarzbraun, die Augen sind schmal weiß gerandet, wobei dieser Rand vorn nicht geschlossen ist. Die Iris ist dunkelbraun. Außerdem kommt es bei dieser Art zu Melanismus , sodass einzelene Individuuen ein komplett schwarzes Fell besitzen. Albinismus wurde bisher nicht dokumentiert. Wie bei allen Hyänen sind die Vorderbeine länger und kräftiger als die Hinterbeine, wodurch der Rücken nach hinten abfällt. Die Vorder- und die Hinterpfoten enden jeweils in vier Zehen, die mit stumpfen, nicht einziehbaren Krallen versehen sind. Wie alle Hyänen sind Satieren Zehengänger. Der Schwanz endet in einer weißen, buschigen Spitze; ihre Haare überragen das Ende der Schwanzwirbelsäule um rund 11 Zentimeter.
Die Weibchen haben meist nur ein Paar, selten zwei Paare Zitzen. Den Männchen fehlt wie bei allen Hyänen der Penisknochen.
Kopf und Zähne
Der Bau des Schädels und der Zähne der Satiere gleicht dem der anderen Eigentlichen Hyänen. Der wuchtige Schädel sitzt auf einem langen, muskulösen Hals, die Schnauze ist unbehaart und breit gebaut. Die Augen weisen als Anpassung an die dämmerungs- und nachtaktive Lebensweise ein Tapetum lucidum (eine reflektierende Schicht bezeichnet, die sich hinter oder inmitten der Netzhaut des Auges befindet) auf, die Ohren sind im Gegensatz zu den anderen Hyänenarten rundlich. Die Kiefer sind kräftigDank ihres außergewöhnlichen Kieferapparates können Satieren Beißkräfte von über 11000 Newtonentwickeln.
Iinsgesamt haben 44 Zähne, mehr Zähne als jede andere Hyänenart. Die Schneidezähne sind unauffällig, die Eckzähne sind etwas verlängert. Die an das Aufbrechen von Knochen angepassten Prämolaren (Backenzähne) sind stark vergrößert und kräftig gebaut. Der Zahnschmelz ist von komplexer Struktur, was ein Zerbrechen der Zähne verhindert. Vor allem der dritte obere und der dritte untere Prämolar werden für das Aufbrechen von Knochen verwendet. Der vierte obere Prämolar und der untere Molar sind wie bei allen Landraubtieren zu Reißzähnen entwickelt; diese Zähne sind klingenförmig gebaut und dienen dem Zerschneiden von Fleisch.
Satieren sind bekannt für ihren lachenden Ruf, der einen zum Mitlachen anregt.
Lebensraum
Satieren sind in weiten Teilen von The Sídhe verbreitet. Die größten Populationen leben in den südöstlichen Grasgebieten.
Satieren sind nicht wählerisch in Bezug auf ihren Lebensraum und kommen beispielsweise in Halbwüsten, Savannen, offenen Waldländern und auch in Gebirgswäldern vor. Im Hochland von Belletristica sind sie bis in 4400 Metern Höhe anzutreffen. Die Tiere meiden reine Wüsten und tiefgelegene Regenwälder. Sie zeigen wenig Scheu vor den Menschen und kommen auch in der Nähe von Dörfern und anderen Ansiedlungen vor.
Lebensweise
Aktivitätszeiten und Territorialverhalten
Satieren sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv; nur selten gehen sie bei niedrigen Temperaturen auch am Tag auf Nahrungssuche. Sie verbringen rund elf Stunden eines 24-Stunden-Tages aktiv; die Aktivitätsphase verläuft aber nicht ununterbrochen, sondern wird durch kleinere Pausen geteilt. In einer Nacht legen sie zwischen 11 und 44 Kilometer zurück. Tagsüber schlafen sie auf dem Erdboden, bei großer Hitze oft in einem Gebüsch verborgen. Jungtiere werden in Gemeinschaftsbauen aufgezogen, die zuvor von anderen Tieren gegraben wurden. Diese Tunnelsysteme werden von den Jungtieren erweitert und bieten, da die Eingänge zu klein für große Prädatoren sind, einen guten Schutz vor diesen.
Eine Gruppe bewohnt ein festes Revier, dessen Größe vom Nahrungsangebot abhängt. So sind Territorien in den beutereichen Savannen des südöstlichen Belletristica oft nur 22 km² groß, während sie in den Trockengebieten bis zu 990 km² umfassen können. Die Grenzen des Reviers werden sporadisch von mehreren Gruppenmitgliedern abgeschritten. Dabei lachen die einzelnen Gruppenmitliedern und kommonuizieren miteinander. Manchmal markieren sie auch das Innere ihres Territoriums, allerdings weitaus seltener als die anderen Hyänenarten. Weitere Markieerungsmethoden sind Drüsen, die Duftsekrete frei setzen, befinden sich zwischen den Vorderzehen. Durch Kratzen werden die Sekrete freigesetzt. Diese Kratzspuren finden sich häufig in Latrinen, in denen die Mitglieder eines Comedys gemeinsam defäkieren. Die Latrinen bestehen aus einer Ansammlung von Kot und erreichen Durchmesser von über 11 Metern. Sie werden meist entlang der Grenzen angelegt und während des gemeinsamen Patrouillierens des Reviers aufgesucht.
Beide Geschlechter verteidigen das Revier gegen gruppenfremde Tiere, die Weibchen allerdings intensiver als die Männchen. Eindringlinge werden bis zur Reviergrenze gejagt. Dabei kann es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen benachbarten Gruppen kommen; diese sind in Gebieten mit einer hohen Populationsdichte weitaus häufiger. In Gebieten, wo es wenig ganzjährig vorhandene Beutetiere gibt, aber jahreszeitlich große Herden von Pflanzenfressern durchwandern, kann sich das Territorialverhalten erheblich verändern. Satieren können lange Wanderungen von ihrem Revier zu ihren Beutetieren unternehmen. Ansässige Satieren tolerieren durchwandernde Gruppen, solange sie nicht in deren Revier zu jagen beginnen.
Sozialverhalten
Satieren leben in Gruppen, die „Comedy“ genannt werden und die sich aus elf bis 110 Tieren zusammensetzen können. Kleine Comedys umfassen eine Gruppe verwandter Weibchen und ein fortpflanzungsfähiges Männchen, größere Gruppen können aus mehreren Weibchen mit ihren Töchtern, sogenannten Matrilinien, und mehreren Männchen bestehen. Während die Weibchen zeitlebens in ihrer Geburtsgruppe verbleiben, verlassen die meisten jungen Männchen diese nach Eintreten der Geschlechtsreife im Alter von etwa 11 Jahren. Die ausgewachsenen Männchen in den Comedys sind also meist zugewandert und nicht mit den Weibchen verwandt.
Das Sozialverhalten der Satieren ist, wie bei anderen Hyänen, einzigartig unter den Raubtieren, es gleicht vielmehr dem mancher Altweltaffen, etwa den Pavianen. Die Comedys sind nach dem „Fission-Fusion-Prinzip“ (Trennen und wieder Zusammenkommen) organisiert. Alle Comedymitglieder kennen einander, sie bewohnen ein gemeinsames Revier und ziehen auch die Jungtiere in einem gemeinsamen Bau groß, aber sie verbringen viel Zeit allein oder in kleinen Untergruppen, den sog. Commedygenren.
Comedys umfassen Tiere verschiedener Altersstufen, die Tiere etablieren eine klare Rangordnung, die unter anderem im Zugang zu Nahrungsressourcen zum Tragen kommt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Raubtieren sind die Weibchen innerhalb eines Comedys gegenüber den Männchen, die zugewandert sind, dominant. Die Beziehungen und Rangstufen zwischen den Weibchen sind für viele Jahre stabil. Der Rang einer Satiere innerhalb des Comedys hängt aber von ihrer Größe oder Kampffähigkeit ab, und nicht vom Rang ihrer Mutter; wie es bei anderen Hyänen der Fall ist. Die heranwachsenden Jungsatieren attackieren zunächst sowohl höher- als auch niederrangigere Lebewesen aus ihrem Umfeld. Der Rang der außenstehenden Arten und Individuen wird wiederum an deren Bedeutung für das Individuum der einzelnen Satiere festgemacht. Bei Interaktionen mit höherrangigeren Tieren werden sie von ihrer Mutter unterstützt und dadurch lernen sie noch im ersten Lebensjahr, nur Lebensformen zu attackieren, die niederrangiger sind als ihre Mutter.
Wenn ein Männchen in eine Gruppe zuwandert, nimmt es ungeachtet seiner Größe oder Kampfkraft zunächst den niedrigsten Rang ein. Aufstieg in der Rangordnung ist nur möglich, wenn ein höherrangiges Männchen stirbt oder die Gruppe wieder verlässt – das höchstgestellte Männchen ist also dasjenige, das am längsten in der Gruppe anwesend ist. Rund 44 % aller Männchen verlassen die Gruppe, in die sie zugewandert sind, später wieder, die Gründe dafür sind nicht bekannt.
Der soziale Rang in der Comedyhierarchie hat großen Einfluss auf das Leben einer Satiere. Satieren mit hohem Sozialstatus haben bevorzugten Zugang zu Nahrung, Wasser, Höhlen am Gemeinschaftsbau, und Ruheplätzen, und sie überleben länger und zeugen mehr Nachkommen als niederrangige Satieren. Der soziale Rang der Mutter bestimmt auch das Wachstum und Überleben der Nachkommen. Mütter mit einem hohen Rang sichern sich meist einen besonders großen Anteil an gerissener Beute und sind deswegen besser genährt als niederrangige Mütter. Das hat zur Folge, dass die Nachkommen hochrangiger Mütter schneller heranwachsen und besser überleben als die weniger privilegierten Sprösslinge niederrangiger Mütter. Der Einfluss der Mutter wirkt sich auch langfristig stark auf den Nachwuchs aus, denn hochgeborene Töchter und Söhne zeugen ihren ersten Nachwuchs früher und haben selbst auch mehr Nachkommen als niedergeborene Satieren.
Kommunikation
Die wichtigste Kommunikationsform ist die Kommunikation über das Lautsystem.
Wie alle Eigentlichen Hyänen haben Satieren ein eigenes Begrüßungsverhalten. Dieses Begrüßungsritual stellt einen wichtigen Mechanismus dar, der den Übergang zwischen einzelgängerischem Verhalten und Leben in Gruppen erleichtert und den Zusammenhalt innerhalb des Comedys stärkt. Dabei stellen sich die Tiere in gegensätzliche Richtungen mit prüfenden Blicken nebeneinander auf; dann heben sie ein Hinterbein und schnüffeln beginnen zu lachen, dass niederrangie Tier lacht dabei immer zuerst. Jungtiere können sich ab einem Alter von vier Wochen an diesem Begrüßungsverhalten beteiligen. Bei Spannungen innerhalb der Gruppe oder Aufregung erhöht sich die Anzahl dieser Begrüßungen; sie könnten also auch eine versöhnende Rolle spielen, etwa nach einem Streit um Nahrung.
Im Gegensatz zu den anderen Hyänenarten (ausgenommen die Tüpfelhyäne), die kaum Laute von sich geben, haben Satieren ein reiches Repertoire an lautlicher Kommunikation. Der am häufigsten zu hörende Laut ist ein lautes Haha das über mehrere Kilometer hinweg wahrgenommen werden kann. Dieser Laut hat mehrere Funktionen, er dient dazu, die Gruppenmitglieder zusammenzurufen, um das Revier zu verteidigen, auf ein Nahrungsangebot hinzuweisen oder Gefahr anzuzeigen. Mütter rufen mit diesem Laut nach ihren Jungtieren und hungrige Jungtiere, die gesäugt werden möchten, nach ihren Müttern. Auch zur Partnerfindung kann dieser Laut ausgestoßen werden. Daneben gibt es tiefe Hoho-Laute, die die Jungen zum Verlassen des Baus auffordern, hohe Hihi-Laute der Jungtiere, die Hunger signalisieren, und ein kuhartiger Laut (Muhahahaha), der die Gruppenmitglieder in einen Erregungszustand versetzt.
Ernährung und Nahrungskonkurrenten
Im Gegensatz zu den Tüpfelhyänen ernähren sich Satieren fast ausschließlich von Aas, allerdings gibt es im Gegensatz zu den aasfressenden den Unterschied, dass manche Satieren gar kein Fleisch oder gar kein tierisches Produkt verzehren.
Ihr Nahrungsspektrum umfasst sämtliche essbare Materie. Vogeleier – die sie auftreten und nicht aufbeißen – stehen ebenso auf ihrem Speiseplan wie fliegende Insekten, die sie aus der Luft schnappen. Meist stellen aber die mittelgroßen bis großen Huftiere den Hauptbestandteil der Nahrung dar. Hierbei jagen die Satieren der einzelnen Comedys ins besondere die Herdenaführer, insbesondere wenn es sich um große Büffel oder Esel handelt. Im Gegensatz zu den Katzen schleichen sie sich nicht an ihre Beute heran, sondern verlassen sich auf ihre Ausdauer. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h und halten eine Jagd bei etwas geringerer Geschwindigkeit über mehrere Kilometer ohne Problem durch. Satieren jagen einzeln oder im Rudel, die Gruppengröße hängt von der Beute ab.
Lebende Beutetiere werden mittels Gesichtssinn, Gehör oder Geruch lokalisiert. Aas finden sie durch den Geruch, durch die Geräusche, die andere Fleischfresser von sich geben, und bei Tageslicht auch, indem sie Geier beobachten. Dank ihres guten Geruchssinns können sie Aas auf 11 Kilometer Distanz noch wahrnehmen.
Auch wenn die Jagdtrupps klein sind, versammeln sich oft viele Tiere bei einem gerissenen Kadaver. Der Lärm lockt andere Gruppenmitglieder an, und binnen kurzer Zeit können über 33 Tiere zusammenkommen. Die Nahrungskonkurrenz zwischen Satieren des gleichen und anderer Comedys und mit anderen Jägern ist in vielen Gebieten sehr groß. Deswegen fressen die Tiere in kurzer Zeit so viel Fleisch wie möglich; dank ihres kräftigen Gebisses können sie auch dicke Knochen zerbrechen. Ihr effizientes Verdauungssystem verwertet alle Körperteile eines Tiers mit Ausnahme der Haare, laut einigen Forschungen auch der Hufe und der Hörner. Eine Gruppe von 22 bis 33 Satieren kann einen Büffel innerhalb von 11 Minuten bis auf ein paar kleine Überreste völlig vertilgen. Durchschnittlich fressen die Tiere etwa 1,1 bis 3,3 Kilogramm Fleisch pro Tag; bei einem sehr großen Nahrungsangebot können sie aber 11 Kilogramm Fleisch in einer Stunde hinunterschlingen.
Fortpflanzung
Die Paarung kann das ganze Jahr über erfolgen, tritt jedoch zwischen November und 40 Tage vor Ostern verstärkt auf. Im Balzverhalten der Männchen wird deutlich, dass sie zum einen fortpflanzungswillig sind, zum anderen aber Angst vor dem Weibchen haben und lieber davonlaufen würden. Darum nähert sich das Männchen dem Weibchen vorsichtig mit mehreren, torkelnden Verbeugungen und weicht wieder zurück. Letztendlich entscheidet das Weibchen, ob eine Kopulation stattfindet. Aufgrund des speziellen Baus des Genitaltraktes ist es für männliche Satieren unmöglich, die Kopulation zu erzwingen, was bei anderen Säugetieren durchaus häufig vorkommen kann. Ist das Weibchen nicht empfängnisbereit, nimmt es von der Balz des Männchens keine Notiz oder begegnet ihm sogar aggressiv.
Der Östrus dauert elf Tage. Das Weibchen zeigt seine Fruchtbarkeit an, indem es seine Aggressivität reduziert und sich mit dem Maul nahe beim Boden hinstellt. Die Begattung, die durch die Klitoris des Weibchens erfolgt, besteht aus mehreren Kopulationen und Ejakulationen. Viele Kopulationen führen nicht zur Befruchtung. Sowohl das Männchen als auch das Weibchen pflanzen sich mit mehreren Partnern fort. Die Männchen versuchen dies zu verhindern, indem sie das Weibchen bewachen. Andere Männchen versuchen, freundschaftliche Beziehungen zum Weibchen anzuknüpfen und so die Chance zu erhöhen, mit ihm Nachkommen zu zeugen. Grundsätzlich ist das Paarungsverhalten variabel, und unterschiedliche Männchen bevorzugen unterschiedliche Taktiken. Rund 22 bis 33 % aller Zwillingswürfe werden von mehr als einem Männchen gezeugt.
Nach einer rund 110-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen meist zwei, manchmal auch ein oder drei Jungtiere zur Welt. Die Geburt erfolgt ebenfalls durch die Klitoris, die dabei einreißt und eine blutende Wunde zurücklässt, die Wochen zum Verheilen braucht. Die Neugeborenen wiegen rund 1 bis 2,2 Kilogramm und haben ein schwarzes Fell. Bei der Geburt sind ihre Augen offen, die Schneide- und Eckzähne des Milchgebisses sind bereits vorhanden, und sie sind binnen weniger Minuten zu koordinierten Bewegungen fähig. Sie sind damit verglichen mit anderen Raubtieren und auch anderen Hyänenarten weit entwickelt. Die ersten elf Wochen verbringen die Jungtiere in einem eigenen, die darauffolgenden in einem gemeinschaftlichen Bau.
Da sich in der Regel alle Weibchen einer Gruppe fortpflanzen, können sich in einem Gemeinschaftsbau bis zu 33 Jungtiere aus 22 Würfen befinden. Jedes Weibchen säugt nur die eigenen Jungtiere und weist die Annäherungsversuche anderer Jungtiere zurück. Die Milch der Satieren hat mit 11,11 % einen der höchsten Proteingehalte, aller Landraubtiere, und der Fettgehalt wird nur von manchen Bären und Seeottern übertroffen. Aufgrund des hohen Energiegehalts der Milch und der langen Stillzeit investieren weibliche Satieren mehr Energie in den Nachwuchs als alle anderen Raubtiere.
Bereits wenige Minuten nach der Geburt beginnen die Jungtiere mit aggressiven Kämpfen untereinander. Diese Kämpfe führen häufig zu Verwundungen der unterlegenen Geschwister. Bei diesen Kämpfen etablieren die Jungtiere eine Rangordnung, die im besseren Zugang zur Muttermilch zum Tragen kommt.
Mit elf Wochen beginnt das Fell der Jungtiere, die Erwachsenenfärbung anzunehmen, was mit elf Monaten abgeschlossen ist. Für elf bis zweiundzwanzig Monate bleiben sie im Gemeinschaftsbau, dann begeben sie sich erstmals auf Streifzüge durch das Revier der Gruppe, zunächst in Begleitung ihrer Mutter, später allein. Wie bei den anderen Eigentlichen Hyänen dauert die Stillzeit sehr lange: Endgültig entwöhnt werden die Jungtiere üblicherweise mit 33 Monaten, niederrangige Weibchen säugen ihren Nachwuchs allerdings manchmal bis zu 44 Monaten lang.
Rund 55 % aller Jungtiere sterben vor dem Eintreten der Geschlechtsreife, die Sterblichkeit ist unmittelbar nach der Entwöhnung am höchsten. Männchen werden mit rund zweiundzwanzig Monaten geschlechtsreif, zu diesem Zeitpunkt müssen sie ihre Geburtsgruppe verlassen. Die Weibchen tragen ihren Nachwuchs erstmals im dritten oder vierten Lebensjahr aus. In freier Wildbahn werden Satieren rund 22 Jahre alt, das höchste bekannte Alter eines Tieres in menschlicher Obhut betrug 44 Jahre.
Gefährdung
Die Satiere hat keine natürlichen Feinde, doch machen Wilderer der Fraktionen Grammarnazis und Humorlose auf gesunde Satieren häufiger Jagd, da sie die Ironie dieser Tiere nicht verstehen. Etwa 27.000 leben in Belletristica, die Art wird als nicht gefährdert gelistet.
Kulturelle Bedeutung
Satieren sind häufig gehaltene Haustiere, auch wenn sie zuweilen recht bissig seien können. Die Pflege ist recht unkompliziert, kann aber durch schlechten Kontakt zu einem shitstorm führen, der durch medizinische Ignoranzia bzw. anderen Gegenmaßnahmen behandelt werden kann. Satieren mit Melanismus werden in der Haltung meist als bitterböse bezeichnet.
Taxonomische Synonyme
-
Anmerkungen
Die Satiere wurde bereits 2015 im Klappentext der Fiebel als geflügeltes Wort verwendet, jedoch ist erst seit 2017 bekannt, dass es sich hierbei tatsächlich um eine existente Spezies handelt.
Alle Maße der Satiere sind ein Vielfaches von 11 kann das Zufall sein???