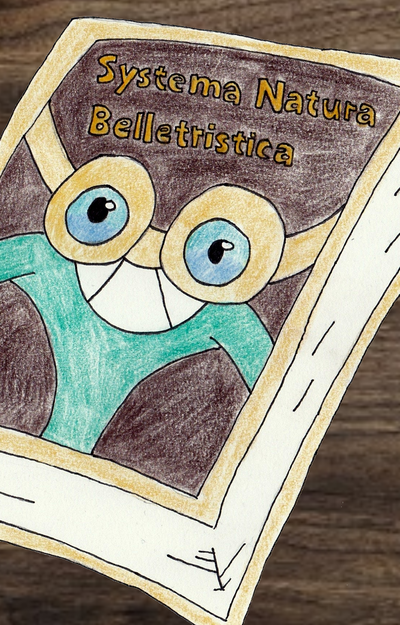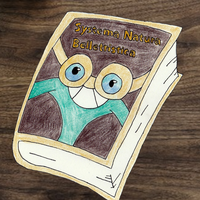Definition des Registers
Der Himbeerfröschchen (Oophaga rubidaeus) ist eine Art der Familie Baumsteigerfrösche (Dendrobatidae). Seinen Namen erhielt er von seiner himbeerroten Färbung.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Klasse: Amphibien (Amphibia)
Unterklasse: Lissamphibia
Ordnung: Froschlurche (Anura)
Unterordnung: Neobatrachia
Überfamilie: Dendrobatoidea
Familie: Baumsteigerfrösche (Dendrobatidae)
Unterfamilie: Dendrobatinae
Gattung: Oophaga
Spezies: Oophaga rubidaeus (Himbeerfröschchen)
Beschrieben: CARO-CHAN 2021
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Himbeerfröschchen erreichen eine Körpergröße von lediglich 14,2 bis 22 Millimeter. Als Anpassung an die Oophagie (Eiverfütterung) gehört das vergrößerte und angepasste Mundfeld der Himbeerfröschchen mit einem stark ausgeprägten Hornschnabel und den vergrößerten Marginalpapillen.
Ihren Namen erhielt der Frosch von seiner meist einfarbig vorliegenden himbeerroten Farbe. Gelegentlich treten auch gelbe und schwarze Farbschläge auf, welche vor allem in der Haltung eine Bedeutung besitzen und in der Natur mehrheitlich eine Randerscheinung darstellen. Männchen lassen sich von den Weibchen anhand eines grünen Kehlflecks unterscheiden.
Giftigkeit
Das Himbeerfröschchen gehört zu den schwach giftigen Pfeilgiftfröschen in seinem Gift, dem Rubidatoxin, welches sich aus 34 verschiedenen Aldehyden und Ketronen (viele davon giftig), 32 verschiedenen Alkoholen (einige davon giftig), 20 verschiedene Ester (die meisten davon giftig), 14 verschiedene Säuren (fast alle davon giftig), 3 Kohlenwasserstoffe und 7 Verbindungen anderer Stoffklassen zusammensetzt. Wird das Gift oral aufgenommen, betäubt es die Zunge mit einem Geschmack von Himbeere. Diese Betäubung kann mehrere Stunden anhalten. Wird der Frosch verzehrt, passiert also den Rachenraum, wird er unweigerlich zu starken Durchfällen und großem Wasserverlust führen. Gelangt das Gift in die Blutbahn, erkrankt man am "Himbeerfieber", welches mit Schwellungen und einem himbeerroten Gesicht einhergeht, sich aber nach einigen Tagen Bettruhe problemlos überstehen lässt.
Diese Giftstoffe bildet das Himbeerfröschchen nicht selbst, sondern nimmt sie über die Nahrung auf.
Lebensraum
Der Lebensraum des Himbeerfröschchens umfasst die Tropen und Subtropen in Communica, The Sídhe und dem nordwestlichen Merkandt. Ihre Vorkommen liegen überwiegend auf dem Land in feuchten Flachgebieten und gebirgsnahen Waldgebieten, größere Populationen finden sich aber auch auf Ruderalflächen wie Himbeerplantagen.
Lebensweise
Ernährung
Himbeerfröschchen ernähren sich von Ameisen, Termiten, Käfern, Trauermücken, Fliegen und anderen Gliederfüßer in passender Größe. Die Beute wird dabei mit der klebrigen Zunge erbeutet. Kaulquappen ernähren sich von den unbefruchteten Eiern, welche ihnen das Muttertier in regelmäßigen Abständen in die Bromelientrichter legt.
Verhalten
Himbeerfröschchen sind tagaktiv und hauptsächlich in Bodennähe oder in Sträuchern (meist Himbeersträucher) anzutreffen. Männchen zeigen sich territorial und verteidigen ihre Reviere über Artgenossen stärker, wenn die Reviere eine höhere Qualität besitzen. Damit ist gemeint, dass die Reviere ressourcenreich sind und/oder ein erhöhtes Vorkommen von Himbeersträuchern besitzt. Dabei kommt es nur selten zu Lautäußerungen, generell gilt das Himbeerfröschchen als eher stiller Frosch.
Fortpflanzung
Die Paarungszeit der Himbeerfröschchen erstreckt sich in der Regel über die Regenzeit. Zur Befruchtung der Eier kommt es nicht durch eine, für Frösche üblich, Umklammerung. Die Paarung erfolgt ventral (bäuchlings). Das Weibchen legt ihre drei bis fünf Eier an einer geschützten Stelle ab und das Männchen befruchtet diese. Das Männchen bewacht und bewässert das Gelege in den nächsten Tagen. Nach etwa zehn bis zwölf Tagen schlüpfen die Kaulquappen, die nun vom Männchen und dem Weibchen einzeln in ein Kleinstgewässer (z.B. wassergefüllte Bromelientrichter, bevorzugt Bromelien mit roten oder rosaroten Blütenblättern, wie die Himbeerbromelie (Brewcaria rubidaeus)) transportiert werden. Dabei klettern die kleinen Frösche zuweilen mehrere dutzend Meter an einem Urwaldriesen hinauf. Die Kaulquappen werden in diesen "Babypools" vom Weibchen in regelmäßigen Abständen mit unbefruchteten Eiern (Nähreier) gefüttert. Nach rund 40 Tagen ist die Metamorphose zum Jungfrosch abgeschlossen und die Jungfrösche verlassen ihre geschützte Kinderstube.
In Haltung erreichen Himbeerfröschchen eine Lebenserwartung von 6 bis 8 Jahren. Wie alt sie in der Natur werden, ist dabei unbekannt.
Gefährdung
Das Himbeerfröschchen findet heute Aufmerksamkeit in der Terrarienhaltung, deren Bestände sich aber fast ausschließlich auf Nachzuchten aus gehaltenen Individuen decken. Da in Sídhe die Rodung von Holz nur für den Eigenbedarf gestattet ist, sind die Tiere auch vor Holzschlag und Lebensraum weitestgehend sicher. Illegale Holzfäller können kleineren Populationen gefährlich werden, es gibt Vermutungen, dass die Bestände in Merkandt sich im Rückgang befinden, hierzu fehlen aber noch vollständige Daten. Die BCS listet das Himbeerfröschen in der Bunten Liste als nicht gefährdet.
Es wird im Biotopenpark gehalten und seit kurzem auch erfolgreich nachgezüchtet.
Kulturelle Bedeutung
Gefährlichkeit für den User
Aufgrund ihrer eher schwachen Giftwirkung sind selbst wilde Himbeerfrösche für den User unbedenklich.
Haltung
Die lebhaften Frösche benötigten einen gewissen Platz, dass Terrarium für ein Pärchen oder eine Gruppe von drei bis 5 Exemplaren muss daher mindestens 70 x 50 x 50 Zentimeter groß sein. Zur vollständigen Einrichtung sind mehrere Versteckmöglichkeiten, einen Wasserteil, die richtige Beleuchtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu beachten. Die Haltung der Frösche gilt als für ambitionierte Anfänger geeignet.
Nachzuchten besitzen in der Regel kein Gift.
Nutzung
Der Stamm der Ibimerai, auch Herbali genannt, da sie im Bereich der Herball Hills leben, sammelt regelmäßig Himbeerfröschchen um an den Fröschen ähnlich wie an einem Lolly zu lecken. Die Frösche werden nach kurzer Zeit wieder entlassen, sobald sich ihre Giftwirkung verringert oder aber der Froschlutscher genug Zerstreuung durch die betäubte Zunge (der damit verbunden seltsam klingenden Aussprache) und den Himbeergeschmack erhalten hat.
Systematik
-
Anmerkungen
Trivia
Die Art basiert u.a auf dem Erdbeerfröschchen (Oophaga pumilio) und der Himbeere (Rubus idaeus).