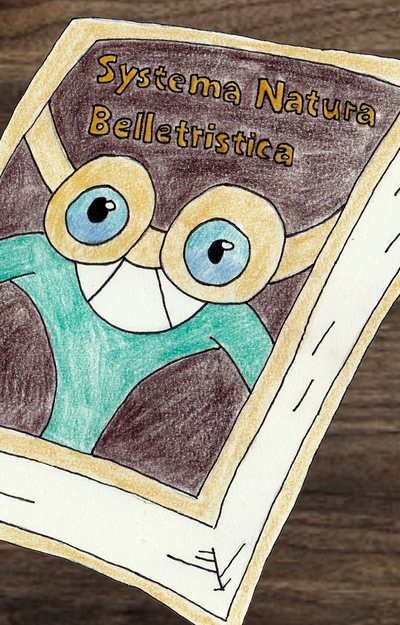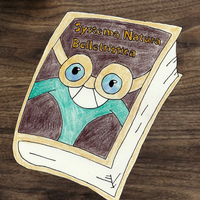Definition des Registers
Die Wolfskoralle (Acropora lupus) ist eine Steinkoralle (Scleractinia). Sie ist eine der Korallenarten, welche oft die oberen, stark durch Wellen bewegten Bereiche der Korallenriffe dominiert. Sie ist ein Symbiosepartner des Korallenwolfs kann aber auch ohne diese in der Natur angetroffen werden, wo sie Kalkskelette ausbildet und so einen wichtigen Teil beim Riffbau beiträgt.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Nesseltiere (Cnidaria)
Klasse: Blumentiere (Anthozoa)
Unterklasse: Hexacorallia
Ordnung: Steinkorallen (Scleractinia)
Familie: Acroporidae
Gattung: Acropora
Spezies: Acropora lupus (Wolfskoralle)
Beschrieben: MARV & FELIX 2020
Merkmale
Diese Korallenart bildet drei Grundtypen aus, welch aufgrund ihrer Formen ursprünglich für drei Arten gehalten wurden. Genetische Untersuchungen ergaben, dass diese Typen alle der gleichen Art angehören und keine Unterarten darstellen, da sie von einem zum anderen Grundtypen wechseln können, auch wenn dies nur bei einem der beiden Typen bisher beobachtet wurde.
Der häufigste Typ der Wolfskoralle ist zeitgleich der unscheibarste, der Riffbildene Typ zeichnet sich durch große Verästelungen und Plattenbildung aus, welche eine wichtige Rolle in der Bildung neuer Riffe darstellen. Die Äste dieses Korallentyps erreichen Durchmesser von elf bis zwanzig Zentimetern. Kolonien, welche in sich verwandt sind, bilden sog. Dächer aus. Bei diesen wachsen die Verästelungen zusammen und es bildet sich eine geschlossene Kalkskelettplatte, auf der eine Vielzahl von Polypen sitzen. Unter solchen Platten beinden sich wahre Labyrinthe aus Korallenäste, welche Lebensraum für viele Fische und Krebstiere bilden. Im Lauf der Zeit werden die Lücken dann mit Sediment gefüllt.
Von diesem Typ losgelöst ist der Symbiose-Typ der Wolfskoralle, dieser ist nur im Fell des Korallenwolfs (Canis korallion) anzutreffen. Hier überzieht die Wolfskoralle mit ihrem Kalkskelett ein Haar des Wolfs auf dem eine handvoll Polypen Platz finden. Im Gegensatz zur eher blassgrünen Riffform ist die Symbioseform ungemein farbenfroh und variiert von kräftigen Rot- und Orangetönen, über satte Gelbtöne, diverse Blau- und Grüntöne bis hin zu violett und Rosatönen. Befinden sich im Wolfsfell zwei Kolonien gleicher Verwandtschaft beieinander, wachsen sie zusammen, so kommt es im Wolfsfell gelegentlich zur Bildung kleiner Platten, welche vor allem auf dem Rücken und den Flanken größer werden und so dem Wolf eine Art Panzerung verleihen.
Die dritte Form der Wolfskoralle ist die Bruchform. Diese Form bildet sich nur aus, wenn eine Symbioseform aus dem Fell des Korallenwolfs löst und dabei die Haarwurzel mit sich nimmt. Diese wird von der Bruchform assimiliert und führt zu einem äußerst ungewöhnlichen Ergebnis. Die Bruchform entwickelt ein Kalkskelett, welches an einen Wolf erinnert, die Maße stimmen laut einer Studie mit dem Ursprungs-Korallenwolf über ein. Was den Schluss nahelegt, dass die Koralle die DNA der Haarwurzel als eine Bauplanerweiterung für ihr Kalkskelett nutzt.
Die Wolfskoralle besitzt ein leichtes Nervengift, welches den Polypen schützen soll und besonders auf Fische lähmend wirkt. Größere Säugetiere verspüren im allergischen Fall ein leichtes Taubheitsgefühl, können aber problemlos weiter schwimmen.
Verbreitung
Die Wolfskoralle lebt im tropischen Gürtel der belletristicanischen See. Dabei zeichnet sich die Bruchform als kälteresistenter aus, als die anderen Formen und so wurde sie auch schon in gemäßigteren bzw. mediterranen Meeresgebieten nachgewiesen.
Lebensweise
Ernährung
Die Wolfskoralle ernährt sich von Plankton.
Fortpflanzung
Bei der sexuellen Fortpflanzung laichen die Korallenpolypen der Wolfskoralle, oft gesteuert durch die Mondphasen, ab. Dabei gilt der Vollmond als Hauptlaichzeit. Wie die meisten anderen Korallenarten vermehrt sich die Wolfskoralle durch externe Befruchtung. Dabei geben die Korallenpolypen gleichzeitig Spermien und Eizellen ab. Die Befruchtung, durch die Masse der abgegebenen Keimzellen begünstigt, findet dann im freien Wasser statt. Die befruchteten Eizellen entwickeln sich zu Planula-Larven, diese zweischichtige, bewimperte, ovale Form ist nur wenige Millimeter groß und schwimmt die ersten sechs Lebenswochen frei im Oberflächenwasser. Die Ansiedelung kann in zwei Möglichkeiten erfolgen: Möglichkeit 1: Die Larve heftet sich an einem festen Untergrund an, wo sich ein radiärsymmetrischer Polyp mit Kalkskelett ausbildet. Oder aber die Larve verfängt sich während ihrer freischwimmenden Periode im Fell eines Korallenwolfs. Dort binden, über biochemische Prozesse, die Wimpern an der Haarwurzel bzw. direkt über dieser an der Haut des Wolfes, wo sich ein Kalkskelett um das Haar bildet und mehre Polypen zeitgleich gebildet werden. Verfängt sich die Wolfskoralle bei anderen Wölfen oder Säugetieren, kommt es nicht zu dieser Verschmelzung, da nur der Korallenwolf die geeignete Haarstruktur für die Verschmelzung besitzt.
Gefährdung
Die Wolfskoralle gilt in Belletristica heute noch als häufig, doch setzt auch ihr der Klimawandel zu. Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die Winterinvasion, sollte sie nicht zurückgedrängt werden, könnten Kälteeinbrüche ganze Korallenriffe der Wolfskoralle dahin raffen. Diese Worst-Case-Bedrohungen bedrohen die aktuellen Bestände aber nur geringfügig, weshalb die BCS die Art als nur gering gefährdet klassifiziert.
Die Art wird im Biotopenpark in allen drei Formen präsentiert und nachgezogen. 2020 starte im Juli das Projekt Seawolf in dem mehrere Tonnen voll Salzwasser und Korallenpolypen vor der Küste Ostorigins entleert wurde, um neue Korallenriffe zu etablieren und alte aufzuforsten.
Kulturelle Bedeutung
Kunst
Insbesondere die Bruchform besitzt einen gestalterischen und künstlerischen Wert, da die eine von der Natur geschaffene Wolfsskulptur darstellt. Bruchformen werden deshalb häufiger in Vorgärten gestellt. Dort müssen sie aber bemalt werden, da die farbenfrohen Polypen in solchen dem Meer entnommen Kalkskeletten fehlen.
Systematik
-
Anmerkungen
-