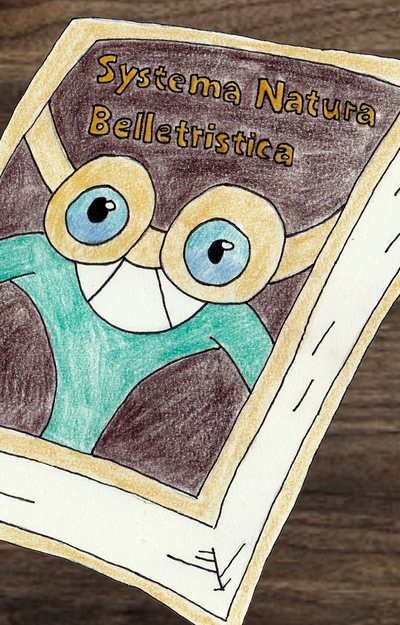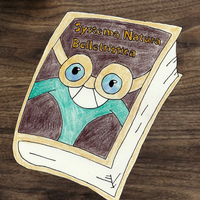Definition des Registers
Der Colabär (Phasecolaarctos cola) ist ein baumbewohnender Beutelsäuger in Origin. Sein lateinischer Name Phasecolaarctos ist eine Wortspielerei mit dem Gattungsnamen der Koalas Phascolarctos und setzt sich beim Colabären aus Phase Cola und dem lateinischen Wort für Bär zusammen, was auf die klebrige colaartige Gestalt hinweist.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Synapsiden (Synapsida)
Klasse: Säugetiere (Mammalia)
Unterklasse: Beuteltiere (Marsupialia)
Überordnung: Australidelphia
Ordnung: Diprotodontia
Unterordnung: Vombatiformes
Familie: Koalas (Phascolarctidae)
Gattung: Phasecolarctos
Spezies: Phasecolarctos cola (Colabär)
Beschrieben: WD 2020
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Der Colabär wird 61 bis 85 Zentimeter groß und wiegt zwischen 4 und 14 Kilogramm. Im kühleren Klima lebende Colabären sind im Allgemeinen größer und haben ein dunkleres und klebrigeres Fell als das von Tieren in wärmeren Regionen. Diese Regel wird von Ausnahmen außer Kraft gesetzt, so sind sowohl sehr kleine, als auch sehr große Exemplare aus dem fruchtbaren Crikey-Forrest im Biotopenreservat bestätigt.
Der Koala hat bräunlich bis schwarzbraunes, klebriges Fell, aus dem bei Kontakt mit Regenwasser regelmäßig eine coffein-, kohlensäurehaltige und ungemein klebrige Flüssigkeit tropft. Auffallend sind weiter die zwei mit spitzen, scharfen Krallen versehene Greifhände mit jeweils zwei Daumen und drei entgegengesetzten Fingern, die sich gut zum Klettern und Ergreifen von Zweigen eignen. Dabei wird das Greifen von der klebrigen Sekretsflüssigkeit, welche den gesamten Körper umgibt, unterstützt und erlaubt dem Colabären das Klettern an Decken und Gläsern. Charakteristische Merkmale sind eine vorstehende, dunkle Nase, welche als einzige nicht von der klebrigen Flüssigkeit bedeckt sind (woher sich das Sprichwort "einen Colabären an der Nase greifen" ableitet) und große Ohren. Männchen unterscheiden sich durch Hodensack und Duftdrüsen an der Brust von den Weibchen, die durch ihren Beutel auf der Bauchseite gekennzeichnet sind. Zusätzlich besitzen geschlechtsreife Männchen an den Ohren rote Randlinien. Der Beutel ist wie bei anderen Koalas und Wombats (im Gegensatz zu den Kängurus) mit nach unten gerichteter Öffnung ausgestattet.
Colasekret
Das Colasekret des Colabären wird über Drüsen in das Fell gegeben und von diesem so lange gehalten, bis es übersättigt ist und vom Körper des Colabären tropft. In der Regel wäre eine solche Felleigenschaft ungemein hinderlich, da sie einem Beutegreifer leicht den Aufenthaltsort eines Colabären verraten würde. Allerdings ist das Sekret und die Haut des Colabären koffeinhaltig, Koffein ist ein Alkaloid und bereits ab einer Menge von 10 Gramm für den Menschen tödlich, erste Vergiftungssymptome sind bereits bei einem Gramm erkennbar. Während das Fell und jegliche Körperflüssigkeit des Colabären eine Gesamtmenge von 8 Milligramm beinhält und damit eher als erfrischend, wenn auch klebrig betrachtet werden kann. So ist die Haut des Beuteltieres deutlich Koffeinhaltiger und kommt auf eine Gesamtmasse von 1 bis 3 Gramm Koffein, dies ist für Raubtiere bis 36,7 Kilogramm tödlich und verursacht bei fast allen Beutegreifern mindestens Vergiftungserscheinungen in Form von Übelkeit. Ein Schutzmechanismus um aufgrund der süßen Körperflüssigkeiten nicht von Beutegreifern bis zur Ausrottung gejagt zu werden.
Lebensraum
Colabären waren ursprünglich in Origin weit verbreitet, wurden aber wegen ihres Fells gejagt und dadurch in vielen Gebieten ausgerottet. Sie konnten teilweise wieder angesiedelt werden. Größere Populationen sind entlang der Ostküste Origins und in Gegenden im Hinterland, in denen es genügend Futterbäume gibt, zu finden.
Lebensweise
Ernährung
Die Tiere ernähren sich fast ausschließlich von den Früchten der Kolanuss (Cola) und den Blättern von Rotholzgewächsen (Erythroxylaceae), hierbei im Besonderenvon Vertretern der Gattung Erythroxylum. Innerhalb ihres Nahrungshabitates sind Colabären sehr sesshaft und wechseln das Revier nur bei einem Nahrungsmangel (meist alle 5 bis 7 Jahre).
Verhalten
Colabären sind Baumbewohner, der Waldboden wird nur betreten, um einen Baum zu wechseln. Die aktive Zeit erstreckt sich über den späten Nachmittag und die Nacht. An Tage ruhen die Tiere im Geäst der Bäume. Colabären leben in der Regel Einzelgängerisch und so findet man pro Baum in der Regel nur einen Colabären, Ausnahmen sind Mütter die mit ihren Jungen zusammen leben. Die Reviere einzelner Individuen überschneiden sich. Die Reviergrenzen werden von den Männchen mit Colasekret markiert. Mehrere Reviere bilden eine Kolonie, innerhalb der Kolonie existiert eine strikte Hierarchie. Colabären emittieren eine Reihe von Lauten, die einem wehleidigen Schrei eines Kindes ähneln können oder wie das Zischen einer Flasche. Die Rufe sind nicht selten auch über große Entfernungen zu hören. Ein Zeichen der Dankbarkeit, aber auch von Angst, sind die Colatränen. Sie werden in den Tränendrüsen gebildet und entsprechen in der Konsistenz einer handelsüblichen Cola. Diese besonderen Tränen sammeln sich in einer Höhle unter dem Augenlid und können mithilfe von Muskeln bis zu sechs Meter weit verspritzt werden. Als Verteidigung funktioniert die Colaträne nur gegenüber Angreifern, die sich vom Geruch oder Geschmack von Cola abschrecken lassen. Colatränen werden ebenfalls im Fall der Rührung ausgeschüttet, diese Tränen schmecken deutlich besser, als die Colatränen, welche aus Angst vergossen werden.
Fortpflanzung
Colabären erreichen mit etwa zwei Jahren die Geschlechtsreife. Erfolgreiche Begattungen finden jedoch meist erst ein bis zwei Jahre später statt. Die Weibchen pflanzen sich zum ersten Mal meist schon früher fort, da die älteren dominanten Männchen die jüngeren vom Geschehen fernhalten. Es ist umstritten, ob die Männchen auf die Suche nach Weibchen gehen oder umgekehrt. Möglicherweise hängt dies von der Klebrigkeit des Tieres ab und wie sehr es mit dem Baum und seiner Umgebung haftet. Während der Fortpflanzungszeit sind Colabären aktiver als sonst. Während dieser Zeit geben männliche Koalas oft ein weitreichendes Plopp- und Zischgeräusch von sich. Dieses Geräusch dient der Reviermarkierung, aber auch zur Information für die paarungsbereiten Weibchen. Bei den Colabären bestimmen grundsätzlich die Weibchen, wann die Paarung vollzogen wird. Die Paarung erfolgt, je nach Gebiet, zwischen Oktober und April.
Männchen paaren sich während der Paarungszeit mit allen erreichbaren Weibchen. Die Tragzeit beträgt 35 Tage. Bei der Geburt krabbelt das Junge selbständig aus dem Geburtskanal in den Beutel. Es wiegt dann weniger als ein Gramm und ist etwa 2 Zentimeter lang, blind und nackt. Im Beutel hindert ein kräftiger Schließmuskel das gänzlich umhüllte Junge am Herausfallen. Es wird meist nur ein Junges im Sommer geboren, welches sechs bis sieben Monate im Beutel heranreift und gesäugt wird.
Nach rund zwölf Monaten ist das Junge selbständig genug, sodass das Muttertier erneut trächtig werden kann. In der Regel werden die Jungtiere etwa im Alter von 18 Monaten von der Mutter vertrieben. Wird die Mutter allerdings nicht erneut trächtig, kann das Junge den mütterlichen Schutz bis zu drei Jahre genießen.
In der Natur werden Colabären 15 Jahre alt, wobei dieses Alter nur von Weibchen erreicht wird, Männchen werden selten älter als 10. In Haltung erreichten Colabären, wie die Coladame Pep im Biotopenpark, ein Alter von 19 Jahren.
Ökologie
Aufgrund ihres süß saftenden Fells sind Colabären im Sommer häufiger von Wespen umschwärmt, diese können zwar potenzielle Beutegreifer vertreiben, aber auch den Colabären stechen. Es ist zwar selten, dass mehrere Wespen einen Colabären stechen, da sie nicht durch die klebrige Sekretschicht kommen, die Nase des Tieres ist aber ungeschützt und sein wunder Punkt. Selten kommt es daher vor, dass ein Colabär an Wespenstichen stirbt.
Gefährdung
Die gesamte Population wird auf 45.000 bis 80.000 Tiere geschätzt. Colabären sind besonders anfällig auf Veränderungen ihres Lebensraumes, so benötigen sie ausreichenden Zugang zu den wenigen Futterpflanzen, die sie fressen. Die BCS listet die Art als gefährdet und als sinkend in der Bestandszahl.
Er wird im Biotopenpark und Elles Lesezoo gehalten und nachgezüchtet.
Kulturelle Bedeutung
Colabärsi & Colla
Colabärsi und Colla sind zwei ähnliche Erfrischungsgetränke, welche ursprünglich die Flüssigkeit des Colabären sammelten, um ihre Getränke herzustellen. Dabei pflückten sie regelrecht die Beuteltiere von den Bäumen und zogen mit speziellen Schwämmen sämtliche Flüssigkeit aus dem Fell. In der Folge erkrankten viele Colabären und die Population brach um 80 Prozent ein. Auf Druck der Öffentlichkeit wurden die Erfrischungsgetränke nun künstlich hergestellt und heute muss kein Colabär mehr seine Flüssigkeit für die Erfrischung opfern (es sei denn er will das so).
Erster Bericht
Erstmals wurde der Colabär von WD in einem Reisebericht am Bärnesstag 2020 vorgestellt https://belletristica.com/de/books/28036-colabaren-pantherrobben-und-ich/chapter/130636-colabar
Redewendung
Der Colabär ist manchen durch die Redewendung "Einen Colabären an der Nase greifen" bekannt. Der Ausspruch beschreibt damit eine Person, die für sich nur den genehmsten Weg wählt und nicht berücksichtigt, wie es anderen damit geht. Sie leitet sich von der Tatsache ab, dass man einen Colabären nur dann Packen könne, ohne sich mit dem Colasekret einzusauen, indem man ihn an der Nase greift. Dies kann allerdings für den Colabären sehr unangenehm sein. Da der Colabär die Zusammensetzung seines Sekrets über Enzyme permanent steuert, kann man seine Kleidung am besten schützen, in dem man ihn richtig und behutsam greift, dem Tier also letztlich signalisiert, dass man keine Gefahr ist.
Zoologische Haltung
Eine Haltung des Colabären erfolgt u.a. in Elles Lesezoo https://belletristica.com/de/books/13593-elles-lesezoo/chapter/133327-colabar
Systematik
-
Anmerkungen
-