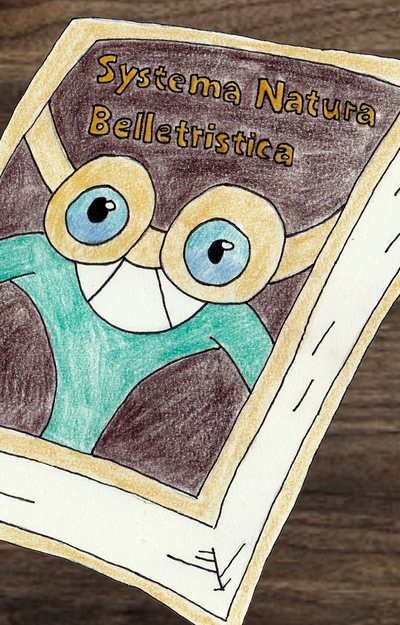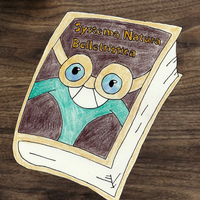Definition des Registers
Das Wohnhuhn (Gallus villa) ist eine Hühnervogelart aus der Familie der Fasanenartigen (Phasianidae). Der Artname villa (= Landhaus) referenziert das Verhalten der Wohnhüher große Lauben- und Hütten als Nester zu bauen. Aufgrund dieser Lebensweise wird es auch Hüttenhuhn genannt.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Sauropsida (Sauropsida)
Klasse: Reptilien (Reptilia)
Ohne Rang: Eureptilien (Eureptilia)
Ohne Rang: Diapsida
Ohne Rang: Archosauromorpha
Ohne Rang: Archosauriformes
Ohne Rang: Crurotarsi
Ohne Rang: Archosauria
Ohne Rang: Avemetatarsalia
Ohne Rang: Dinosauromorpha
Ohne Rang: Dinosaurier (Dinosauria)
Ohne Rang: Echsenbeckensaurier (Saurischia)
Ohne Rang: Theropda
Unterklasse: Vögel (Aves)
Teilklasse: Neukiefervögel (Neognathae)
Überordnung: Galloanserae
Ordnung: Hühnervögel (Galliformes)
Überfamilie: Phasianodea
Familie: Fasanenartige (Phasianidae)
Unterfamilie: Pavoninae
Tribus: Gallini
Gattung: Kammhühner (Gallus)
Spezies: Gallus villa (Wohnhuhn)
Beschrieben: Pantoffeltierchen 2021
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Das Wohnhuhn erreicht eine Größe von 50 bis 75 Zentimeter sowie ein Gewicht von 550 bis 1.300 Gramm. Hennen bleiben in der Regel deutlich kleiner und leichter als ein Hahn.
Bei dem Männchen ist die Körperoberseite ein dunkles olivfarben. Gesicht und Hals sind etwas heller, der Scheitel ist leicht orangerot überwaschen. Der Mantel und das Schwanzgefieder ist etwas dunkler als die übrige Körperoberseite. Markantes Merkmal ist der fleischige und gelb bis golden gefärbte gezackte Kamm auf dem Oberkopf sowie die ebenso gefärbten Hautlappen im Gesichtsbereich. Bei bestimmten Lichteinfall bilden sich auf diesen Körperpartien weiße Glanzlichter.
Die Körperunterseite ist dunkel ockerfarben, dabei sind die Brustseiten und die Flanken etwas dunkler, das Kinn und die Kehle etwas heller. Die Iris ist dunkelbraun, der Schnabel ist schwärzlich, mit einer blauen Schnabelbasis. Die Beine und Füße sind dunkelgrau.
Das Weibchen ähnelt dem Männchen in der Gefiederfärbung, ist aber in allen Farben etwas matter. Der Kamm ist rudimentär und ockerfarben, die Hautlappen sind ebenfalls deutlich kleiner als beim Männchen.
Lebensraum
Die natürliche Verbreitung reicht von Homestead entlang des River of Discovery in Adventuria nordwärts bis ins südliche Uta. Sowie den vorgelagerten Inseln der Regionen Adventuria und Homestead. Frei lebende Populationen gibt es auch in Communica in der Nähe der Taverne, wie in Origin und Teilen von The Sídhe. Sie wurden von Usern oder NPCs dort eingeführt.
Wohnhühner bevorzugen Waldränder und Kulturräume. Da sie dort diverse Materialien finden, um ihre Villen zu schmücken. Dabei sind die Kulturfolger vor allem in waldähnlichen Lebensräumen, wie Plantagen, besonders häufig zu finden. Die Art besiedelt vorrangig die tropischen und subtropischen Klimata, findet sich aber auch im gemäßigten Klima zurecht. Aride und Polare Regionen werden gemieden. Als vorrangige Flachland-Art findet man das Wohnhuhn meist nur in den Niederungen. Ausgenommen davon sind die sog. Almhüttenhühner, welche auf Almen und anderen Bergwiesen in einer Höhe von überwiegend zwischen 1300 und 1500 Meter anzutreffen sind.
Lebensweise
Ernährung
Wohnhühner gelten als Allesfresser. Gefressen werden Gräser und Kräuter, allerlei Sämereien und Körner sowie Insekten, deren Larven, Würmer und Schnecken. Die Nahrung wird ausschließlich am Boden gesucht. Dazu scharrt das Wohnhuhn mit den Füßen auf dem Waldboden und pickt potenzielle Nahrung auf. Die Nahrungssuche und -aufnahme erfolgt tagsüber.
Verhalten
Adulte Wohnhühner leben als Einzelgänger und finden sich nur zur Paarung zusammen, wobei die Männchen fast das ganze Jahr mit ihrer Laube beschäftigt sind. Männliche Wohnhühner bleiben, nachdem sie flügge sind, eine gewisse Zeit in der Nähe der adulten Männchen und schauen sich von diesen das Handwerk des Laubenbaus Errichtens ab. Sodass in den meisten Subpopulationen ein gewisser Baustil vorherrschend ist.
Laubenbau
Die Laubenvillen der Wohnhühner folgen dem Prinzip eines zentralen Maibaumes, der zwischen Baumsprösslingen erbaut wird. Es handelt sich dabei um eine Konstruktion, bei der Ästchen um einen dünneren Baumstamm oder um einen Baumfarn gefügt werden. Dabei entsteht eine Säule aus Ästchen um den eigentlichen Stamm.
Der Maibaum ist allerdings nicht frei stehend, sondern überdacht von einem hüttenartigen Dach mit Öffnung zu einer großen zentralen Tenne. Die Tenne ist eine größere Stelle des Waldbodens, welche zunächst gereinigt und mit Blättern ausgelegt wird. Aufgrund der Eigenart auch Blüten und andere bunte Pflanzenteile in der Tenne zu drapieren, wird diese beim Wohnhuhn auch als Vorgarten bezeichnet.
Diese Eingänge messen zwischen 45 und 95 Zentimeter und sind zwischen 50 und 70 Zentimeter hoch. Entsprechend handelt es sich um imposante Bauten, weshalb die Laubennester der Wohnhühner als Villen bezeichnet werden. Einige wenige Lauben besitzen dem Haupteingang noch einen Nebeneingang mit zweitem Laubdach. Solche bauten werden im gesamten Verbreitungsgebiet gefunden und als Prunkvillen bezeichnet. Das zentrale Element der Laubenvilla ist häufig 150 bis 225 Zentimeter hoch und die Bodenfläche misst bis zu 3,75 Meter im Durchmesser. Eine besonders große Laube im The-Seven-Mountains-Gebirge wurde von zwei Baumsprösslingen gestützt und deckte eine Grundfläche von 7,5 mal 5 Metern ab. Die Höhe betrug 3,75 Meter.
Verbaut für die großen Nester werden überwiegend Stängel und Zweige diverser Pflanzen. Gelegentlich werden die Dächer der Villenlauben, oder die gesamte Villenlaube, aus Farnen errichtet, was der Villenlaube ein ungemein ungewöhnlisches Erscheinungsbild gibt. Der Innenraum sowie der Vorhof der Villenlaube sind fein gesäubert und mit vom Wohnhuhn herbeigebrachtem Moos bedeckt. Die Plattform des Maibaums ist Moos. Die Moosplattform hat typischerweise einen Durchmesser von 50 bis 35 Zentimeter und ist 38 Zentimeter hoch. Die Moosplattform wird von Vertrettern in kühleren Regionen meist grün belassen, gelegentlich wird sie um vertrocknete, braune Moosteilchen ergänzt. Die Moosplattformen von Populationen in den tropischen und subtropischen Gebieten werden von den Wohnhühner bemalt. Dabei kommen verschiedene Farbstoffe zum Einsatz, wie von Früchten, Blüten und anderen Elementen, beispielsweise kristallinem Feenstaub, was zu einem leuchtenden orange der Moosplattform führt.
Da die Laubenvillen einen großen Arbeitsaufwand bedeuten, werden sie von dem Wohnhuhn nicht aufgegeben, sondern immer wieder repariert, ausgebaut und verfeinert.
Fortpflanzung
Die Geschlechtsreife erreichen Wohnhühner mit fünf bis sechs Monaten. Die Paarungszeit erstreckt sich in der Regel über das Frühjahr und kann sich bis in den Sommer hinein erstrecken. Männchen der gemäßigten und kühleren Regionen verpaaren sich meist nur mit einem Weibchen, Männchen der Tropen hingegen mit mehreren Weibchen. Grund dafür ist, dass in kühleren Regionen das Weibchen in die Laubenvilla des Männchens einzieht und sich so den aufwendigen Nestbau sparen kann, hier vertreibt das Weibchen weitere Geschlechtspartnerinnen. In tropischen Regionen, wo Nistmaterial um einiges leichter zu erhalten ist, bauen sich die Weibchen häufig kleinere Nester, um ihre Brut weniger auffällig auszubrüten. Da hier das Weibchen in der Laubenvilla fehlt, kann sich das Männchen mit weiteren Weibchen verpaaren.
Ein Weibchen legt pro Tag ein Ei, das Gesamtgelege umfasst größtenteils vier bis sechs Eier. Die embryonale Entwicklung im Ei erfolgt über einen Zeitraum von 21 Tagen. Die Küken sind Nestflüchter und folgen kurz nach dem Schlupf der Mutter. Diese verlässt mit den Küken das Nest, sobald das letzte geschlüpft ist. Die Nahrungsaufnahme erfolgt unter Anleitung der Mutter selbständig. Mit etwa 35 Tagen sind die Jungtiere voll befiedert. Im Alter von drei Monaten werden die Jungtiere flügge.
Die Lebenserwartung liegt bei acht bis zehn Jahren.
Gefährdung
Aufgrund ihres großen Verbreitungsgebiets erscheint die Art noch nicht vom Aussterben bedroht zu sein. Lebensraumverlust setzt dem Wohnhuhn zu, ebenfalls die Zerstörung von Laubenvillen, durch unachtsames Verhalten. Größtes Problem der Wohnhühner ist aber die Hybridisierung mit anderen Hühnern, welche die genetische Vielfalt der Wohnhühner in Siedlungsgebieten stark limitiert hat. Da unklar ist, wie weit diese Hybridisierung fortgeschritten ist, betrachtet die BCS die Art vorerst als nicht gefährdet. Es könnte aber eine ernstere Bedrohung vorliegen, der Bestand gilt als abnehmend.
Die Art wird im Biotopenpark gehalten und nachgezüchtet.
Kulturelle Bedeutung
Haus- und Nutztier
Aufgrund ihrer einzelgängerischen Lebensweise eigenen sich Wohnhühner nicht für die kommerzielle Landwirtschaft. Als Haltung für Hühnerliebhaber haben sie in der Belletristicanischen Tierhaltung aber eine Nische eingenommen.
Gelegentlich finden Wettbewerbe statt, bei denen Halter die Laubenvillen ihrer Wohnhühner miteinander vergleichen lassen und einen Gewinner küren lassen.
Symbolik
Das Wohnhuhn gilt als Sinnbild des guten, luxuriösen Wohnens. Aufgrund dieses Umstandes werben Möbelhäuser und Architekten mit diesem Tier und nutzen es als ihr Maskottchen.
Unter Architekten ist es dabei besonders beliebt und wurden von der Homestead Architektengilde nicht nur als Wappentier gewählt, sondern zu einer Auszeichnung gemacht. Das goldene Wohnhuhn wird jedes Jahr für ambitionierten Bauprojekte vergeben und ist durch ein großes Preisgeld die Aufstiegschance für junge Architekten in Homestead und ganz Belletristica.
Systematik
-
Anmerkungen
Trivia
Zur Erstellung des Wohnhuhn-Artikels wurden das Bankivahuhn (Gallus gallus) und die Laubenvögel (Ptilonorhynchidae) Goldhaubengärtner (Amblyornis macgregoriae) und Hüttengärtner (Amblyornis inornata) mit einander vermischt.