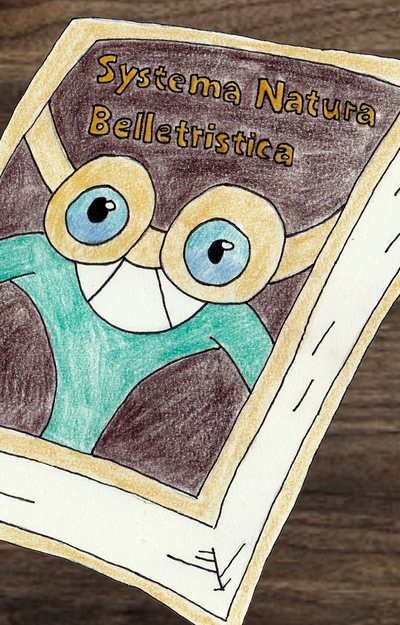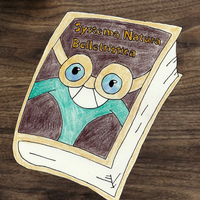Definition des Registers
Die Kreischfroschzikade (Dundubia cornicarirana) ist eine Art der Familie der Singzikaden (Cicadidae). Sie ist für ihre lauten Ahhhhhhhhhhhh!-Rufe bekannt, die während des Rufens immer leiser werden, als würde sich die Zikade von ihrem Standort entfernen. Sie wird auch Fallzikade genannt.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Gliederfüßer (Arthropoda)
Unterstamm: Sechsfüßer (Hexapoda)
Ohne Rang: Dicondylia
Unterklasse: Fluginsekten (Pterygota)
Teilklasse: Neoptera
Überordung: Condylognatha
Ordnung: Schnabelkerfe (Hemiptera)
Unterordnung: Zikaden (Auchenorrhyncha)
Teilordnung: Rundkopfzikaden (Cicadomorpha)
Überfamilie: Cicadoidea
Familie: Singzikaden (Cicadidae)
Unterfamilie: Cicadinae
Tribus: Dundubiini
Gattung: Dundubia
Spezies: Dundubia cornicarirana
Beschrieben: MARV 2020
Unterart(en): Bisher keine bekannt
Merkmale
Die Kreischfroschzikade ist etwa 4 Zentimeter lang und besitzt eine Flügelspannweite von 11 bis 13 Zentimetern. Innerhalb des Verbreitungsgebiets existieren diverse Farbmorphen, dabei sind vielfältige Grüntöne die dominierende Färbung, insbesondere Jadegrün. Gelegentlich existieren auch bläuliche oder gelbliche Vertreter. Beide Flügelpaare sind hyalin und können leicht bronzefarben sein. Die Spannweite der Männchen beträgt 35 bis 45 Millimeter und die der Weibchen 30 bis 39 Millimeter. Die Komplexaugen der Kreischfroschzikade sind smaragd- bis jadegrün.
Die Exuvie oder das weggeworfene leere Exoskelett der Nymphenform ist in den Sommermonaten häufig an Baumstämmen in Gärten und Buschland an großen Bäumen zu sehen.
Zwischen den beiden Geschlechtern gibt es optische Unterschiede, der sogenannte Geschlechtsdimorphismus. Die Opercula (mehrere Lider, die die Trommelfellhöhle bedecken) des Männchens sind löffelförmig, nicht seitlich gekrümmt und ihr Ende ist abgerundet; doppelt so lang wie breit und nicht stark eingeengt. Das Opercula ist so lang, dass es das Becken bedeckt und in den meisten Fällen das fünfte Abdomensegment erreicht. Das Mesonotum (Mitte der drei Segmente im Brustkorb eines Insekts) zeigt gelegentlich schwarze Linien. Kopf, Brustkorb und Bauch sind ocker oder hellgrün. Der Aedeagus (das Sperma übertragende Organ) besteht aus zwei breiten und stumpfen Lappen. Der Bauch hat eine einheitliche Farbe ohne schwarze Flecken.
Die Opercula des Weibchens haben keinen Seitenzahn und sind weniger auffällig als beim Männchen. Das Mesonotum zeigt keine schwarzen Linien und ist stets einfarbig. Die Basis des Bauches ist ziemlich spitz und leicht nach oben gebogen. Die lateralen Seiten des Bauches tragen ebenfalls keine schwarzen Flecken.
Kreischfroschzikadenn können, wie andere Zikaden auch, fliegen, springen und laufen, und das – im Gegensatz zu Blattläusen oder Käfern – sogar seitwärts. Dabei sind vor allem die Sprungdistanzen beachtlich, so springt die Kreischfroschzikade aus dem Stand bis zu 70 Zentimeter.
Die lauten Rufe des Männchens sind vornehmlich in den Sommermonaten zu hören. Sie werden als hart wie hoch beschrieben und können 120 Dezibel erreichen. Charakteristisch ist dabei ein Aaahhhhhh*leiser werdend*hhh!-Laut, der die Kreischfroschzikade von allen anderen Zikaden unterscheidet. Da ihr Ruf so klingt, als würde sie sich entfernen oder in einen tiefen Abgrund fallen, nennt man sie auch Fallzikade.
Das Geräusch wird durch das schnelle Knicken des Tymbalorgans (Trommelorgan), welches am 1. und 2. Abdominalsegment sitzt, erzeugt die Zikade durch Resonanz, welche zusätzlich in einem Luftsack verstärkt wird, ihren artspezifischen Ruf. Die Frequenz des Rufs liegt bei 4,3 kHz.
Lebensraum
Kreischfroschzikaden besiedeln weite Teile der Warmzonen Origins und Adventurias. Dort bevorzugen sie Biotope mit starker Sonneneinstrahlung, viel Baumbestand, geringem Vogel- und oder Fledermausaufkommen und Wassernähe. Diese werden vom Frühling bis zum Herbst besiedelt. Im September/Oktober erfolgt die Rückwanderung in die Winterquartiere über Distanzen von bis zu einem Kilometer (nur für adulte Tiere, welche sich nicht verpaart haben, Nymphen bleiben in der Regel unter der Erde und wandern wenig). Diese liegen meist in Baumhöhlen oder unter der Erde.
Lebensweise
Ernährung
Wie alle Singzikaden ist auch die Kreischfroschzikade ein Xylemsauger. Mithilfe ihres Rüssels stechen die erwachsenen Tiere die Leitungsbahnen verschiedener Gehölze an und saugen den an Nährsalzen und Wasser reichen Pflanzensaft (welcher durch das Xylem transportiert wird). Die unterirdisch lebenden Larven saugen den an Zuckern reichen Pflanzensaft von Wurzeln.
Verhalten
Die Art ist nachmittags- und dämmerungsaktiv, in dieser Zeit hört man die Männchen häufig rufen, aber auch die Weibchen rufen gelegentlich, was für Zikaden untypisch ist. Bei beiden Individuen ist der immer leiser werdende Ahhhhhhhhhhhhhh!-Laut zu vernehmen. Man geht davon aus, dass der akustische Entfernungseffekt im Ruf der Zikade, die eigentliche Postion des Tieres verschleiern soll, um sich so vor Fressfeinden zu verbergen. Diese These stützt sich auf Beobachtungen an Weibchen, welche den Ruf nur praktizierten, wenn sie sich bedroht fühlten.
Fortpflanzung
Die mittlere Gesamtlebenszyklusdauer der Kreischfroschzikade beträgt etwa sechs bis acht Jahre, im Schnitt sieben, vom Ei bis zum natürlichen Tod eines Imagos. Dabei verbringt die Kreischfroschzikade einen Großteil ihres Lebens als Nymphe unter der Erde. In der Regel sieben Jahre. Die ausgewachsenen Tiere (Imagos) leben etwa meist sechs Wochen und nutzen die kurze Lebensspanne zum Paaren und Brüten. Der Reproduktionserfolg steht in Abhängigkeit zu Temperatur und Wetterlage, kann sich eine Kreischfroschzikade nicht verpaaren, überwintert sie und versucht ihr Glück im nächsten Jahr.
Ab Mitte Juli legt die Kreischfroschzikade 300 bis 400 Eier ab, die grünlich, 2,5 Millimeter lang und 0,5 Millimeter breit sind. An beiden Enden sind die Eier kegelförmig zugespitzt. Sie werden mehrheitlich unter die Blätter oder Zweige von Bäumen gesetzt.
Gefährdung
Die Kreischfroschzikade ist eine in Origin häufige Art, die BCS listet sie daher als nicht gefährdet. Gelegentlich werden Exemplare aus der Wildnis für den Heimtierbedarf entnommen, allerdings gibt es genügend Nachzuchten und auch sonst ist der Bestand groß genug, um die Entnahme zu verkraften. Die wird im Biotopenpark gehalten und nachgezogen.
Kulturelle Bedeutung
Haustier
In den letzten Jahren werden Kreischfroschzikaden aufgrund ihrer grünen Färbung zu immer beliebteren Terrarienpfleglingen. Insbesondere da die Tiere häufiger auf Hände krabbeln und keine Scheu vor Usern zeigen. Für die Haltung werden Terrarienmit speziellem Schallglas empfohlen, welches verhindert, dass man permanent den Ruf der Tiere hört.
Kopfgeld: 300 Messingtaler
Die Kreischfroschzikade wurde 1708 Teil eines kuriosen Kopfgeldes des Fürsten Ruhdi Jetzema, der von den kleinen Insekten so genervt gewesen war, dass er ein Kopfgeld von 300 Messingtalern pro Kreischfroschzikade bezahlte um endlich wieder in Ruhe schlafen zu können. Die Bewohner eines naheliegenden Dorfs fingen mit ihren Keschern eifrig anzufangen und binnen eine Woche war der ursprünglich reiche Fürst ärmer als der ärmste Bettler. Zu allem Überfluss gab es noch genug Kreischfroschzikaden, dass der Fürst keine Ruhe fand und irgendwann die Gegend verließ.
Bis heute ist nicht geklärt, ob Ruhdi Jetzema und sein verrücktes Kopfgeld existierten, doch legen diverse Quellen den Schluss nahe, dass es sich wirklich um eine wahre Begebenheit handeln könnte.
Plage
Aufgrund ihres lauten, auf Dauer nervtötenden Rufs, werden Kreischfroschzikaden von vielen Gartenbesitzern als regelrechte Plage betrachtet, wenn sie die Sommermonate mit ihren lauten Rufen erfüllen. Zusätzlich können Pflanzen direkt durch den Fraß von Kreischfroschzikaden geschädigt werden oder von diesen Krankheiten in Form von Viren und/oder Pilzen erleiden, bzw. anfälliger für diese sein. Da sie aber große Baumarten und diese den Fraß leicht überstehen können, steht meist die Lärmbelästigung im alleinigen Fokus.
Systematik
-
Anmerkungen
Trivia
Marv entdeckte die Kreischfroschzikade nachdem er dieses Video in der Taverne teilte: https://www.youtube.com/watch?v=MCilHPm4v5E&feature=youtu.be es zeigt eine Grüne Jadezikade (Dundubia vaginata) aus Borneo, sie wurde u.a. als Grundlage für diese Art verwendet.