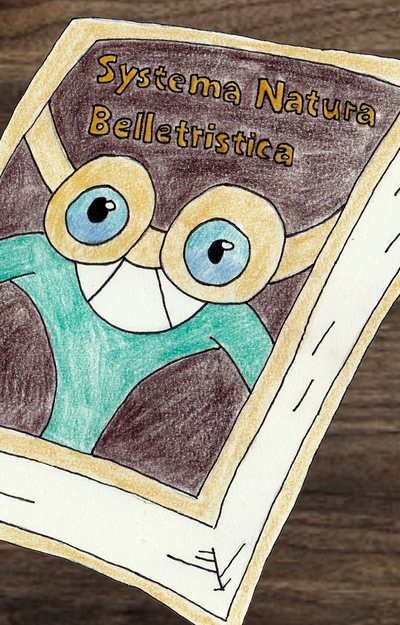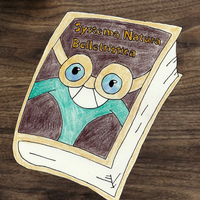Der Hallimatsch (Armillaria lutum) ist ein holzbewohnender Blätterpilz aus der Gattung der Hallimasche. Der Pilz hat einen matschigen Charakter und ist in der Allchemie als Ausgangszutat für die Herstellung von Lehm relevant. Meist können Fruchtkörper dieses Pilzes im Spätherbst gefunden werden.
Taxonomie
Reich: Pilze (Fungi)
Unterreich: Dikarya
Abteilung: Ständerpilze (Basidiomycota)
Unterabteilung: Agaricomycotina
Klasse: Agaricomycetes
Unterklasse: Agaricomycetidae
Ordnung: Champignonartige (Agaricales)
Familie: Physalacriaceae
Gattung: Hallimasche (Armillaria)
Spezies: Armillaria lutum (Hallimatsch)
Beschrieben: Felix et. Bellesima 2022
Unterart(en): Keine
Merkmale
Der Hut erreicht einen Durchmesser von 3 bis 10, manchmal auch bis 20 Zentimeter. Er ist gewölbt, verbreitet, fast schon flach, was mitr dem Alter weiter zunimmt. Die Oberfläche ist dunkelbraun bis lehmfarben und teilweise mit matschigen Schlammklümpchen bedeckt. Gelegentlich erscheinen die Ränder oder der Hut selbst gemasert. Die Lamellen sind feucht und sehr fragil. Sie sind lehmfarben und können sich bei Berührung bereits zersetzten. Die kurzen Stiele sind erdfarbig und entsprechen den lokalbedingten, typisch Erdbodfarben. In Gebieten mit rotem Lehm erscheinen die Stängel somit rötlich, in Gebiet mit dunklem Lehm, braun bis schwärzlich. Das Fleisch ist bräunlich bis braunweiß und besitzt einen intensiven, erdigen Pilzgeruch. Das Sporenpulver ist weiß.
Die Fruchtkörper erscheinen vorwiegend im Spätsommer und Herbst von Juni bis November. Mitunter sind sie auch über das ganze Jahr hinweg zu finden. Sie treten dabei nahezu immer am Stammgrund lebender Bäume auf. Entlang des Stammes bis hin zur Baumkrone sind sie nur dann zu finden, wenn der Baum bereits entwurzelt auf dem Boden liegt.
Lebensraum & Ökologie
Lebensraum
Der Hallimatsch ist nahezu belletristicaweit verbreitet. Ausnahmen bilden zu trockne Regionen, wie polar Regionen, Sandwüsten und andere Extremregionen. In Origin ist die Art weit verbreitet und überall relativ häufig. Die Art kommt vor allem in Sümpfen mit Lehmböden und anderen Lebensräumen mit Lehmboden vor. Neben den Lehmsümpfen besiedelt der Hallimatsch vorwiegend Nadeholzwälder, aber auch Laubholzwälder. Die Art besiedelt dabei vorrangig das Tiefland und wird in höheren Lagen seltener angetroffen.
Da die Art auch Lehmgolems befällt, können diese zur Ausbreitung des Hallimatsch beigetragen haben, da der Pilz sich aber auch von alleine rasch verbreitet, ist der Verbreitungseinfluss der Golems auf die Verbreitung des Pilzes eher gering einzuordnen.
Ökologie
Auf befallenen Substrat lebt der Pilz als Parasit oder Saprobiont. Mit seinen schnürsenkelähnlichen schwarzen Hyphensträngen (Rhizomorphen) kann er unterirdisch große Entfernungen zurücklegen, um geeignetes Substrat zu finden. Dabei befällt er vorrangig Baumwurzeln und bildet unter deren Borke ein bräunlichen Fächermyzel. Vom Myzel durchwachsenes Holz nimmt einen erdigen Geruch an.
Der parasitische Befall des Pilzes führt zum Absterben des Wirtsbaumes. Danach kann sich der Pilz noch einige Jahre saprophytisch vom toten Holz ernähren.
Daneben ist der Hallimatsch ein wichtiger Produzent von Hummus. Die von Hallimatschen angereicherte Erde, fördert das Pflanzenwachstum in besonderem Maße.
Gefährdung
Der Hallimatsch ist weit verbreitet und ziemlich häufig und wird von der BCS als nicht gefährdet angesehen. In Teilen ihres Verbreitungsgebiets sind sie jedoch selten geworden. Größte Bedrohung für diese Art ist das verschwinden ausreichend feuchter Lebensräume, insbesondere der Schwund von Lehmhaltigen Sümpfen.
Im Biotopenpark werden einige Hallimatsche kultiviert.
Kulturelle Bedeutung
Heilkunde
In früheren Jahrhunderten wurde der Hallimatsch als Abführmittel bei Verstopfungen verwendet. Da er bei hohen Dosierungen eine stark abführende Wirkung besitzt. Allerdings gibt es in der Naturheilkunde deutlich bessere Alternativen.
Kulinarische Bedeutung
Gekocht sieht er zwar aus wie Matschepampe überrascht aber mit einem deftigen, leicht erdigen Geschmack und ist deshalb ein nicht zu unterschätzender Speisepilz. Er wird aber nicht von jedem Magen, aufgrund seines erdigen Charakters vertragen. Wie alle Hallimasch-Arten ist er roh brechreizerregend-unbekömmlich und muss deshalb mindestens 8 Minuten lang durchgegart werden.
Mythologie
Es heißt, dass wenn sich mehrere Hallimatsche miteinander verbinden, sie zu Matsch und Schlamm werden, aus dem ein neuer Sumpf gedeiht. Dieser Sumpfschöpfungsmythos ist beispielsweise bei den Naori in Editoria belegt.
Der Hallimolem, auch Hallilehm oder Hallilem, ist ein mythologischer Golem, der angeblich in einer Vollmondnacht aus mehreren Hallimatsch geformt wurde und zum Leben erweckt wurde. Meist sind diese Golems von Sumpfhexen ins Leben gerufen worden um ihre Hütten zu schützen oder den Sumpf an sich.
Schädling
Als Holzzersetzender Pilz ist der Hallimatsch ein Forstschädling unter den Pilzen Belletristicas sogar einer der bedeutendsten. Da er aber auch durch die enorme Humus-Produktion als der "Düngemeister des Waldes" gilt, ist sein Befall für den kurzfristigen Profit des Forstunternehmens schädlich, langfristig betrachtet, kann die Humusproduktion dem Forstbetrieb einen größeren Gewinn bedeuten, als ohne Hallimatschbefall. Weshalb immer mehr Forstbetriebe, den Hallimatsch in ihren Forsten gedeihen lassen.
Ebenfalls befallen Hallimatsche auch Lehmgolems und können diese im Extremfall in ihrer Bewegungsfreiheit durch ihr Myzel einschränken. Allerdings ist ein solch schädlicher Befall eher selten und der Hallimatsch stellt eine Erweiterung des Lehmgolems da ohne diesen zu behindern.
Zauberkunde
In der Zauberkunde lässt sich aus dem Pilz alchemistisch Lehm herstellen.
Systematik
-
Anmerkungen
Trivia
Der Halimatsch basiert in diesem Artikel auf dem Fleischfarbenen Hallimasch (Armillaria gallica), sowie dem Honiggelben Hallimasch (Armillaria mellea) und dem Dunklen Hallimasch (Armillaria ostoyae, Syn.: Armillaria polymyces, Armillaria solidipes s. auct.) Er ist ein für das P&P "Dabei sein ist alles" entwickelte Pilz.