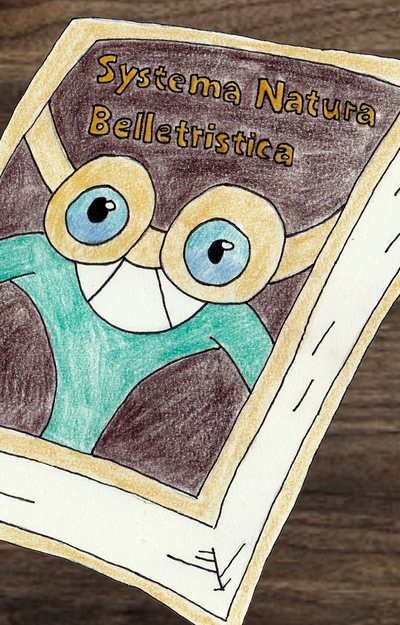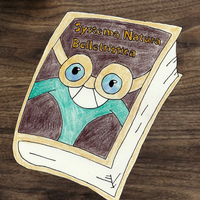Definition des Registers
Das Sonnengesicht (Crossaster solfaciem) ist eine Art der Familie Sonnensterne (Solasteridae) und einer von zwei sehr nah verwandten Vertretern der Gattung Crossaster, welche in Belletristica heimisch sind. Auch wenn die Art in der Lage ist Wärmebildung zu betreiben, wird sie nicht als Wärmekissen verwendet, da es sich um eine hochgiftige Seesternart handelt.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Stachelhäuter (Echinodermata)
Unterstamm: Eleutherozoen (Eleutherozoa)
Überklasse: Asterozoa
Klasse: Seesterne (Asteroidea)
Überordnung: Valvatacea
Ordnung: Klappensterne (Valvatida)
Familie: Sonnensterne (Solasteridae)
Gattung: Crossaster
Spezies: Crossaster solfaciem
Beschrieben: Luan 2018
Unterart(en): Keine bekannt.
Merkmale
Der Belle-Sonnenstern hat acht vergleichsweise kurze Arme und erreicht einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern. Die Oberseite des Sonnengesichts ist goldgelb und deutlich kleiner, als die des nahe verwandten Belle-Sonnensterns (Crossaster solpollo). Sie ist von gemaserter Struktur und erscheint so, als trüge sie ein Gesicht, daher der Name. Die Oberseite besitzt in der oberen Epidermisschicht ein durchsichtiges Gel. Dieses besteht großteils aus Natriumacetat-Trihydrat und ist in der Lage Wärme zu erzeugen. Da Natriumacetat-Trihydrat erst bei 58 °C zu schmilzt, der Seestern aber solche hohe Temperaturen nicht erzeugen kann, hat sich bei dieser Art ein komplexer Biomechanismus entwickelt. Wird Druck auf die Oberseite des Belle-Sonnensterns ausgeübt, wird mit einer Signalkaskade über Rezeptoren der Schlüsselreiz chemisch weitergeleitet. Dies führt zu einer Ausschüttung eines Katalysators, welcher die Schmelztemperatur auf Umgebungstemperatur herabsetzt. Eine schlagartige Wärmebildung ist die Folge. Diese verschreckt oder verbrennt den Angreifer im Idealfall. Thermoproteine im Körper des Belle-Sonnensterns verhindern Schäden durch übermäßige Wärme. Das Gel bleibt auch noch für gewisse Zeit nach der Katalysator Ausschüttung flüssig, selbst dann, wenn der Körper des Belle-Sonnensterns bereits den Katalysator mittels eines Enzyms, der Resorptionsase, zurückführen lässt. Untersuchungen ergaben, dass das Gel selbst bei - 30 °C noch über eine Stunde flüssig seien kann und Wärme abgibt. Als unterkühlte Schmelze in einem metastabilen Zustand flüssig, da das Natriumacetat-Trihydrat sich in seinem eigenen Kristallwasser löst; die Wassermoleküle bilden eine Art eigenes Kristallgitter, das sich zuerst auflöst. Sind noch Reste des metallischen Katalysators im Gel, löst das die Kristallisation aus. Das Gel erwärmt sich dabei wieder auf die Schmelztemperatur, wobei die vollständige Kristallisation und damit die Freigabe der latenten Wärme sich über eine längere Zeit erstrecken kann. Dies ist der Grund für die länger anhaltende Abwärme. Allerdings ist dieser Seestern nicht für die Nutzung als Wärmekissen geeignet, da er bei der Wärmebildung aus Poren sogenannten Sonnentau abgibt. Ein liquides, goldglebes Gift, welches über kleinste Wunden und teilweise durch die Haut, in den Körper eindringen kann, was im schlimmsten Fall zum Tod führt. Die Verbindungen zwischen Armen und Körpermitte passen sich der Untergrundfarbe an, Chromatophoren sind hierfür verantwortlich, welche über Sinnesrezeptoren den Boden genau wahrnehmen und so wieder abbilden können. Wie sinnvoll diese minimale Tarnung ist, ist allerdings fraglich. Die Arme sind im Gegensatz zum Belle-Sonnenstern eckig und wirken wir Streifen. Die dicke Mittelscheibe ist recht groß und weist kein Muster auf. Der Mundbereich ist nackt. Die Madreporenplatte ist klar abgegrenzt. Hierbei handelt es sich um ein typisches Merkmal für den Stamm der Stachelhäuter (Echinodermata). Es besteht aus einem Kanalsystem im Inneren der Tiere, welches mit einer speziellen Flüssigkeit, proteinhaltige Coelomflüssigkeit, gefüllt ist und als Ringkanal den Schlund des Tieres umfasst, von dem fünf Radiärkanäle entspringen. Außen am Tier wird das Ambulacralsystem an den kleinen tentakelartigen Füßchen sichtbar, welcher der Fortbewegung dienen. Er leuchtet im Dunkeln, was durch seine nachtaktive Lebensweise zu tausenden kleinen Lichtern in den Meeren führt.
Lebensraum
Das Sonnengesicht ist in den tropischen Zonen des gesamten Belletristicanischen Ozeans verbreitet. Es lebt auf Schlamm, Sand oder Kies bis in eine Tiefe von etwa 450 Metern. Das Sonnengesicht tritt sowohl in der Brandung als auch an geschützten Orten auf.
Lebensweise
Ernährung
Das Sonnengesicht frisst ausschließlich Steinkorallen, indem er auf sie klettert, seinen Magen über sie stülpt und Verdauungsenzyme ausstößt. Das dadurch verflüssigte Gewebe nimmt er dann auf. Es frisst nur bei Nacht und kann bei Nahrungsknappheit bis zu sechs Monate von seinen Energiereserven leben.
Verhalten
Das Sonnengesicht zeigt kein Sozialverhalten und ist rein nachtaktiv.
Fortpflanzung
Wie bei den meisten Seesternen, so erfolgt auch die Fortpflanzung bei dem Sonnengesicht geschlechtlich, jedoch gibt es viel weniger Männchen als Weibchen. Jedes Jahr im Hochsommer werden Eier und Spermien ins Wasser abgegeben. Zur Laichzeit erscheint da Sonnengesicht in Gruppen, da sonst eher eine geringe Chance auf eine Befruchtung besteht. Durch das vermehrte Auftreten des Sonnengesichts während der Laichzeit kann die Befruchtungsrate bis zu 95 Prozent ansteigen. Ein Weibchen ist in der Lage etwa 65 Millionen Eier pro Saison zu produzieren, sodass, wenn das Sonnengesicht in Gruppen auftritt, das reproduktive Potential enorm ist. Die Populationen können sechsmal in einer Saison laichen. Die Laichzeit synchronisiert mit raschen Veränderungen der Temperatur oder des Lichtes sowie mit sekretierten Hormonen. Männchen und Weibchen geben fast zur gleichen Zeit Spermien und Eier ins Wasser ab, wobei die Weibchen von umher schwimmenden Spermien zur Eiabgabe stimuliert werden.
Die Dipleurula, eine abstrahierte Grundform der Stachelhäuterlarven, ist ein Teil einer Larvenform. Sie ist planktotroph und besitzt einen bilateralsymmetrischen Körperbau mit einer bauchseitigen Mundbucht, die von einem Wimpernband umgeben ist. Mit Beginn der Metamorphose zerfällt das Wimpernband in mehrere Einzelbänder. Im Pentactula-Stadium bilden sich letztlich die Ambulakralfüßchen und die fünf Radiärkanäle mit feinen Wimpern. Mit den Wimpern (Cilien) der Radiärkanälchen strudeln die Larven Planktonorganismen aus dem Wasser herbei.
Innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgt eine Reihe von radikalen Veränderungen. Nach mehreren Kontraktionen sowie seitlichen Verdickungen erscheint das erste Paar Röhrenfüße. Innerhalb der nächsten drei Wochen bildet sich hieraus der vollständige Seestern. Die Geschlechtsreife erreicht das Sonnengesicht am Ende des zweiten Lebensjahres. Es dauert nur drei, bis vier Jahre bis es einen Durchmesser von Armspitze zu Armspitze von etwa 30 bis 40 Zentimetern erreicht hat. Diese rasche Steigerung des Wachstums und der Entwicklung ermöglichen es dem Sonnengesicht, die Sterblichkeitsrisiken als Jugendlicher zu minimieren.
Gefährdung
Das Sonnengesicht nimmt innerhalb seines Verbreitungsgebietes rasch zu und nimmt einen Plagenartigen Charakter ein. Eine Gefährdung ist durch die rasche Vermehrung auszuschließen, Gründe für die massive Vermehrung sind verschieden, unter anderem scheinen Flüsse mit zu viel Düngeranteilen die Fortpflanzungsbereitschaft und Kapazitäten der Art zu steigern. Die BCS stuft die Art als nicht gefährdet ein. Mit dem Biotopenpark wird ein Projekt gegen die Rasche Vermehrung der Sonnengesichter ausgearbeitet und konnte erste Folge erzielen. Ebenfalls werden dort Sonnengesichter gehalten und nachgezogen.
Kulturelle Bedeutung
Beschwörung
Sonnengesichter gehören zu den Tavernenbeschwörungsarten, also jenen, die man generell in der Taverne beschwören kann, ohne ein persönliches Band eingegangen zu sein. Allerdings geht dies nur, wenn ein Sonnengesicht in Nähe ist und man kann auch kein spezielles Individuum beschwören. Die Beschwörungsformel lautet: :sunny:
Gefährlichkeit für User
Sonnengesichter haben an der Oberseite giftige Drüsen. Diese Drüsen können bei ungeschütztem Hautkontakt diffundierendes Gift abgeben. Die Zusammensetzung des Giftes wird seit einigen Jahren erforscht. Verschiedene Bestandteile wie z. B. Phospholipase A2 und Plancitoxine wurden isoliert, sie sorgen für ein schlechtes Verheilen der vergifteten Körperbereiche, andere verdauen diese an und zersetzen sie, wieder andere vermitteln ein brennendes Gefühl und führen zu Brandpusteln. Sollte man das Gift abbekommen, ist umgehend ein Arzt aufsuchen, Kräutertenkturen, aber auch das Übergießen mit Essig und Eiswasser hilft.
Taxonomische Synonyme
-
Anmerkungen
-