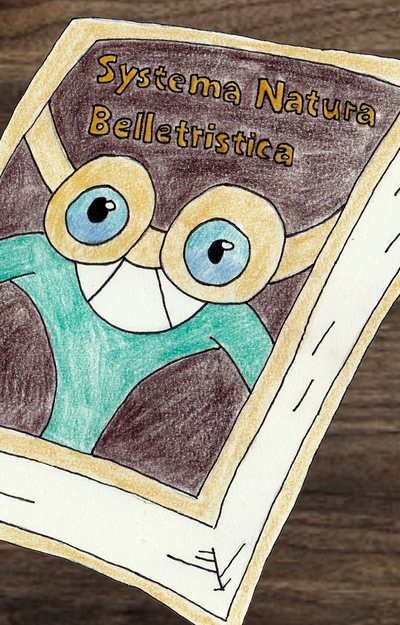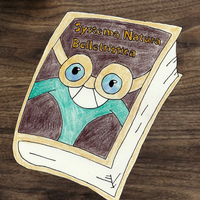Definition des Registers
Das Große Rüschenohr (Stringitauris maxima) ist eine Säugetierart aus der Familie der Chinchillas (Chinchillidae). Wie alle Rüschenohren besitzt es an den Rändern gewellte Ohren und lässt sich so leicht bestimmen. Bekannt ist es vor allem durch seinen Pelz, welcher nicht anreift.
Taxonomie
Reich: Tiere (Animalia)
Stamm: Chordatiere (Chordata)
Unterstamm: Schädeltiere (Craniota)
Ohne Rang: Amnioten (Amniota)
Ohne Rang: Synapsiden (Synapsida)
Ohne Rang: Theria
Unterklasse: Höhere Säugetiere (Eutheria)
Überordnung: Euarchontoglires
Ordnung: Nagetiere (Rodentia)
Unterordnung: Stachelschweinverwandte (Hystricomorpha)
Teilordnung: Hystricognathi
Ohne Rang: Meerschweinchenverwandte (Caviomorpha)
Überfamilie: Chinchillaartige (Chinchilloidea)
Familie: Rüschenohren (Stringitauridae)
Gattung: Eigentliche Rüschenohren (Stringitauris)
Spezies: Stringitauris maxima
Beschrieben: Dirgis 2022
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Die Kopf-Rumpf-Länge des Großen Rüschenohrs beträgt in der Regel maximal etwa 30 Zentimeter bei einem Gewicht von etwa 400 bis 450 Gramm. Damit ist es deutlich größer als sein nächster Verwandte, das Kleine Rüschenohr (Stringitauris minima). Auffallend sind die langen, pelzigen und großen rosa Ohren. Diese sind wie bei allen Rüschenohren an ihren Rändern gewellt und so lassen sich die Nagetiere leicht von Hasen und anderen langohrigen Kleinsäugern unterscheiden. Das Hörvermögen diese Tiere ist besonders gut und kann 10-mal niedrigere Frequenzen hören als Menschen, es ist damit nur halb so empfindlich wie der Hörsinn des Kleinen Rüschenohr, man vermutet, dass die Kleinen Rüschenohren aufgrund ihrer Lebensweise in Höhlen bessere Ohren entwickelt haben.
Die Vorderfüße tragen vier Zehen, die hinteren Zehen sind zum Graben stark vergrößert und auf drei Zehen reduziert. Die Pfoten tragen dicke, schuppige Sohlen; die Krallen sind nur bedingt einziehbar und leicht gekrümmt. Sie fungieren wie Spikes an einem Fußballschuh und geben dem Großen Rüschenohr einen besseren Halt auf dem Boden, sodass die Tiere sehr wendig agieren können.
Die Fellfärbung der Tiere variiert in Braun- und anderen Erdtönen und wird zum Bauch hin heller. Das Fell ist ungemein flauschig und setzt keinen Reif an.
Je nach Bedarf praktizieren sie unterschiedliche Fortbewegungsarten, ein langsames Gehen, ein hasenähnliches Hoppeln oder auch das Hüpfen mit allen vier Beinen. Die maximale Geschwindigkeit liegt dabei auf kurzen Distanzen bei 45 Kilometern die Stunde.
In der Ruhepostionen sitzen die Tiere auf ihrem Gesäß mit ausgestreckten Vorderbeinen oder liegen, ähnlich einer Katze, ausgestreckt mitunter der Brust verschränkten Vorderbeinen. Beides sind Haltungen, die für Nagetiere äußerst untypisch sind, aber den Ruhestellungen der Hasenartigen sehr nahekommen.
Der Ruf des Großen Rüschenohr ist nur selten zu vernehmen und meist ein zaghaftes quicken oder pfeifen.
Lebensraum
Das Große Rüschenohr besiedelt einen größeren Teil des nördlichen Belletristicas, insbesondere Adventuria, Editoria, Acadia und das nördliche Communica. Dort trifft man es in verschiedenen kühlen bis gemäßigten Graslandschaften an. Teilweise sind diese Graslandschaften sehr windexponiert und nur schwer zu bereisen. Durch den Pelzhandel sind einige Tiere auch in andere Gebiete Belletristicas verschleppt worden, diese Verschleppung macht es auch schwierig nachzuvollziehen, woher die Urform des Großen Rüschenohr stammte, man nimmt aber an, dass sie in Communica sich entwickelte, da auch dort das Kleine Rüschenohr existiert.
Lebensweise
Nahrung
Die Hauptnahrung des Großen Rüschenohr sind Beifuß-Gewächse und ähnliche krautige Pflanzen. Im Winter stellen Beifußgewächse bis zu 99 Prozent der Nahrung dar, während im Sommer diese rund 50 bis 60 Prozent ausmachen.
Verhalten
Rüschenohren leben einzeln und finden nur zur Paarung zueinander. Eine Ausbildung von Gruppen erfolgt meist nur, wenn sich mehrere Weibchen und deren Jungen zusammenfinden. Die Männchen sind strikte Einzelgänger und dulden keine Geschlechtsgenossen in ihrer Nähe. Treffen zwei Männchen aufeinander, beginnen sie einander zu imponieren, in dem sie mit den Füßen auf den Boden klopfen, sich an den Boden drücken und in die Höhe recken. Sollte sich der Eindringling nicht vom Imponiergehabe einschüchtern lassen, kommt es zum Kampf, bis das unterlegene Männchen flüchtet. Häufig überlappen die Reviere der Männchen mehrere Weibchenreviere.
Bauten
Das Große Rüschenohr lebt in zweierlei Typen von Erdbauen: in dauerhaften Bauen, in denen die Tiere die Nacht oder ihre Winterruhe verbringen und die Jungen gebären und großziehen, und in vorübergehend bezogenen Schutzbauten, die ihnen als kurzfristige Zufluchtsorte dienen, um vor potenziellen Gefahren, wie Fressfeinden, Schutz zu suchen. Jeder Bau besitzt einen Hauptgang und mehrere Seitengänge sowie Nist- und Nebenkammern. Die Erdbaue werden tagsüber verlassen, um auf Nahrungssuche zu gehen.
Winterverhalten
Mit dem kürzer Werden der Tage, verändert sich der Stoffwechsel der Tiere und baut leichter Fettreserven für den kommenden Winter auf. Zusätzlich fressen die Tiere in dieser Zeit deutlich mehr, um weitere Fettreserven anzulegen, da sie keine Vorräte für den Winter anlegen. Wenn sie genügend Fettreserven gebildet haben, halten sie von Ende August/Anfang September bis März oder April des nächsten Jahres eine mehrmonatige Winterruhe. In Phasen, wo keine Schneestürme ihren Lebensraum heimsuchen, verlassen die Großen Rüschenohren den Bau, um ggf. Fettreserven durch die Aufnahme weiterer Nahrung aufzustocken. In der Regel verlassen sie alle zwei Wochen einmal den Bau.
In sehr kalten Regionen, in denen Schneestürme alltäglich sind, kann es vorkommen, dass die Tiere einen vollständigen Winterschlaf halten und von Ende August/Anfang September bis März oder April ihren Bau so gut wie gar nicht verlassen. Während des Winterschlafs sinkt die Atmung auf etwa zwei Züge pro Minute und der Herzschlag von 200 auf 20 Schläge pro Minute. Der Energieverbrauch sinkt auf weniger als zehn Prozent. Da die Überlebenswahrscheinlichkeit von Winterschlafenden Großen Rüschenohren geringer ist, als bei Winterruhenden Tieren, findet sich dieses Verhalten meist nur in absoluten Extremregionen wieder.
Fortpflanzung
Nach dem Beenden der Winterruhe im Frühjahr findet die Paarung im April oder Mai statt. Die Tragzeit beträgt etwa 77 Tage und fünf bis zehn Junge werden in einer Kammer tief im Bau geboren. Die Jungen kommen bereits sehr weit entwickelt zur Welt und verlassen direkt nach der dreiwöchigen Säugezeit den Bau der Mutter. Mehrheitlich wird das Weibchen kurz nach dem Verlassen der Jungen wieder trächtig. Häufig werfen die Mütter dreimal im Jahr. Die Geschlechtsreife erreichen die Großen Rüschenohren bereits im Alter von 5 Monaten, verpaaren sich aber nie vor dem Ende der ersten Winterruhe. In der Wildnis können die Tiere ein Alter von acht bis zehn Jahren erreichen, in Haltung erreichen sie ein Alter von 14 Jahren.
Gefährdung
Innerhalb des Gebietes findet eine Bejagung der Tiere als Fleisch- und Pelzlieferant statt, die jedoch nicht als bestandsgefährdend eingestuft wird.
Das Große Rüschenohr wird daher von der BCS als nicht gefährdet eingeordnet.
Eine Haltung und Nachzucht erfolgt im Biotopenpark.
Kulturelle Bedeutung
Während das Kleine Rüschenohr für die Kultur der Zwerge eher von geringerem Interesse blieb, ist das Große Rüschenohr für die Zwerge aufgrund seines Pelzes von besonderem Interesse. Dieser setzt keinen Reif an und eignet sich so besonders gut für Winterbekleidung.
Systematik
-
Anmerkungen
Trivia
Das Große Rüschenohr basiert auf einer Mischung aus
Cuvier-Hasenmaus (Lagidium viscacia), Zwergkaninchen (Brachylagus idahoensis), Gepard (Acinonyx jubatus), Kleiner Pampashase (Dolichotis salinicola), Przewalski-Pferd (Equus przewalskii), Blasser Ziesel (Spermophilus pallidicauda), Rotgelber Ziesel (Spermophilus major), Europäischer Ziesel (Spermophilus citellus, Syn.: Citellus citellus) und dem Artikel über das Kleine Rüschenohr (Stringitauris minima).