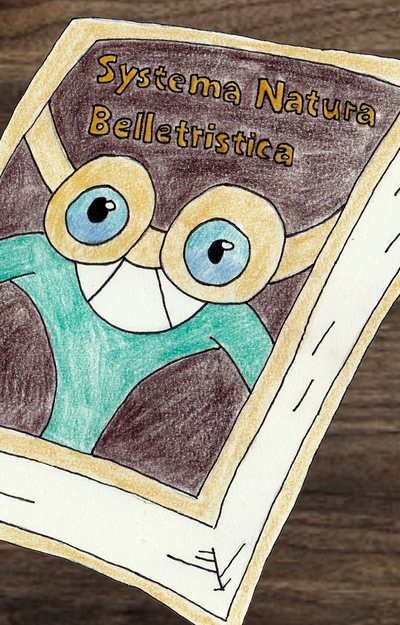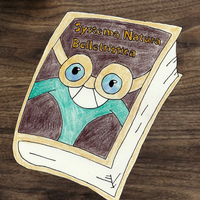Definition des Registers
Der Lichtervogel (Lux xandrai) ist ein mythischer Vogel der in den Berggipfeln von Belletristica sein zuhause gefunden hat. Er gehört zu den seltensten Lebewesen des Kontinents und er ist nur dann zu sehen, wenn er so will. Der Vogel gilt als Zeichen der Hoffnung, Ankündiger von Regen & Gefahren, sowie als Schutzpatron aller Lebewesen.
Taxonomie
Reich: Sagen (Dicere)
Unterreich: Manifestationen (Manifesta)
Stamm: Naturgeister (Spiritus)
Klasse: Elementargeister (Elementae)
Unterklasse: Neuelementare (Neoelementae)
Ordnung: Lichtgestalten (Luxfigura)
Unterordnung: Tierlichter (Animalux)
Teilordnung: Vogellichter (Aveslux)
Familie: Fasanlichter (Lumuphasianidae)
Gattung: Lumuphasianus
Spezies: Lumuphasianus xandrai
Beschrieben: (Xandra 2017)
Unterart(en): Keine bisher bekannt
Merkmale
Der Lichtervogel ist an Hals, Brust und Bauch leuchtend weiß bis goldfarben. Je nach Lichteinfall kann das Gefieder, der restlichen Körperpartien, in den verschiedenen Farben des Regenbogens schimmern. Ohne einen Lichteinfall erscheint das Gefieder weiß. Ein von den Nasenlöchern bis zum Auge reichendes, schmales Band sowie eine breite, halbovale Fläche unter dem Auge ist selbst bei Lichteinfall weiß, da sie unbefiedert ist. Im Verhältnis zum Körper fällt der Kopf eher klein aus.
Die Schleppe des Lichtervogels besteht aus sehr stark verlängerten, 200 bis 220 Zentimeter langen Oberschwanzdeckfedern. Die plastisch leuchtende Federzeichnung löst sich beim Fliegen von den Federn und hinterlässt einen Regenbogen als Spur. Die abgefallenen Partikel werden in regelmäßigen Abständen erneuert. Bevor der Vogel zum Flug aufbricht, setzt er die gefächerten Schwanzfedern in eine laut rasselnde Bewegung, die an Regen erinnert. Der eigentliche Schwanz, welcher zum Steuern beim Flug gebraucht wird, ist 80 bis 100 Zentimeter lang. Dieser besteht aus nicht schillernden, mattgrauen Stützfedern, die von den bunten Schleppenfedern aber überdeckt werden.
Das Schimmern der Federstrahlen wird durch eine feine kristallähnliche Struktur erreicht, diese ist gitterförmig aufgebaut. Welche die Federenden umgibt und so angeordnet ist , dass sie Licht, ähnlich Diamanten oder schillernden Ölflecken auf Wasserpfützen, in unterschiedlichen Winkeln reflektieren. Die Strukturen bestehen aus Diamantenstaub.
Beide Geschlechter tragen eine kleine Federkrone auf dem Scheitel, deren Farbe vom Individum abhängt. Am häufigsten ist die Farbe Gelb, wie auch hellblau. Die Federkronenfarben sind alle blässlichen Naturen. Die Vögel sind ohne Schwanzschleppe, von Kopf bis Schwanzende, 160 bis 220 Zentimeter lang. Dabei erreichen sei ein Gewicht von acht bis zwölf Kilogramm. Die Hennen sind im Vergleich zum Hahn meist etwas kleiner.
Sinne
Der Lichtervogel gilt als ein sehr wachsamer Vogel mit guten Augen. In der Tat kann dieser Vogel wesentlich besser sehen als ein Mensch und sieht selbst aus mehreren Kilometern Höhe noch ausgesprochen scharf.
Flug
In Anbetracht ihrer Größe bewegen sich Lichtervögel in der Luft außerordentlich wendig und schnell. Dabei ist der Flug aber immer grazil und von Anmut geprägt. Lichtervögel können keine Lebewesen im Flug tragen, deren Gewicht das eigene Körpergewicht übersteigt.
Rufe
Alarm-Rufe
Der häufigste Alarmruf ist ein scharfer, rauer und markdurchdringender und wenig gezogener Schrei. Dieser Ruf wird seltener im Gebirge, als im Tiefland vernommen, da der Vogel hier mehr unter Stress zu stehen scheint. Die Töne werden mit "minh-ao" gedeutet, was so viel heißt wie: "Sturm kommt!" In der Tat erschallt der Ruf meist vor Gefahren wie Platzregen oder Stürmen. Viele andere Tiere profitieren von diesen Rufen und können sich so in Sicherheit bringen. In Gebirgen warnt der Ruf vor Schneestürmen oder lockt verirrte Wanderer ins Tal, wo sie sicher sind. Ebenfalls bei Erregung ist ein brummen- bis zischartiger Ton zu vernehmen, dieser wird meist in Nest nähe, bei Gefahr, eingesetzt.
Balzgesang
Der Balzgesang, der meist nach abgeschlossener Revierbildung bei Ankunft eines umherziehenden, und damit noch zu erobernden, Weibchen vorgetragen wird, ist am Anfang leiser, aber auch schneller und lebhafter mit kürzeren Unterbrechungen, als der gewöhnliche Reviergesang. Er ist in der Regel in den Stunden mit Sonnenauf- und vor allem in den Stunden mit Sonnenuntergängen zu vernehmen. Das Weibchen, wenn es diesen Partner, als potentiellen Partner ansieht, erwidert den Gesang des Männchens. Danach vollführt sich ein komplexes Balzverhalten.
Reviergesang
Der Reviergesang der Männchen kann aufgrund seiner Lautstärke bei günstigen Bedingungen bis zu einem Kilometer weit gehört werden (auch ohne wirkendes Echo in den Bergen). Der Vogel singt sowohl Tags, als auch nachts, wobei eine Häufigkeit am Tage zu erkennen ist. Der Gesang ist sehr melodisch, abwechslungsreich und kräftig. Dabei ist er deutlich in Strophen gegliedert, die z. T. durch kurze Pausen voneinander abgesetzt sind. Diese bestehen aus Einzelelementen, die meist einfach wiederholt und zum Teil im Ablauf der Strophe leicht verändert werden können. Der Lichtervogel wiederholt diese Elemente meist häufiger (etwa 6- bis 12-mal). Die Einzelelemente werden langsamer und oft deutlich voneinander abgesetzt vorgetragen.
Der Lichtervogel besitzt, wie die ihm nicht verwandten Nachtigallen, eine sogenannte „Schluchzstrophe“, eine Reihung flötender Laute, die in einem langsamen und dann schneller werdenden Crescendo an Kraft zunehmen. Hierfür werden mit auffälliger Regelmäßigkeit gereihte Schnarrlaute in den Gesang eingeflochten, oft beschrieben als „Schnatter-Phrase“. Die besonders lautstarken Reihen von „Tschuck-“, „Tschjock“ oder „Tschjack“-Lauten werden hingegen als „Kastagnetten-Phrase“ bezeichnet. Insgesamt erhält der Gesang eine schmelzende Note von geradezu berauschender Wirkung.
Nachts werden die Elemente innerhalb der Strophen oft häufiger und schneller hintereinander wiederholt, die Strophen folgen ebenfalls in schnellerer Abfolge aufeinander.
Gesangsaktivität
Die Gesangsaktivität variiert stark, in Gebieten mit hohen Vorkommen kann die stärkere Stimulation durch Reviernachbarn zu einem starken Anstieg der Gesangshäufigkeit führen. Lichtervögel mit Partnern singen melodischer, dafür leiser, als Lichtervögel ohne Partner.
Lebensraum
Lichtervögel besiedeln die borealen, die gemäßigten Zonen Adventurias, Editorias, Acadias und Origins. Wobei sie im Tiefland selten, eigentlich nur auf der Durchreise zu einem anderen Berg, vorkommen. Der Lichtervogel besiedelt in der Regel offene und halboffene Landschaften aller Art, die ein ausreichendes Nahrungsangebot bieten und Felswände oder ältere Baumbestände für die Nestanlage aufweisen. Sein Lebensraum reicht von alpinen Matten über große Moore mit kleinen Wäldern. Große, geschlossene Wälder werden nur randlich besiedelt.
Die starke Konzentration auf Gebirge, lässt sich teilweise mit der Verfolgung durch frühere Verfolgung begründen, da die prächtigen Schleppenfedern als kostbare Schätze betrachtet werden.
Lebensweise
Ernährung
Die Nahrung eines Lichtervogels ist weites gehend vom verfügbaren Angebot bestimmt, den allergrößten Anteil macht dabei aber pflanzliche Kost aus. Lediglich in den ersten sehcs Lebenswochen besteht sie überwiegend aus Insekten, danach nimmt der Anteil der tierischen Nahrung stark ab. Die pflanzliche Nahrung besteht meist aus Sämereien, aber auch aus unterirdischen Pflanzenteilen wie Brutknöllchen, Zwiebeln und Wurzeln. Das Spektrum reicht dabei von den winzigen Samen kleiner Nelkengewächse bis hin zu Nüssen oder Eicheln. Hartschalige Früchte werden genauso gefressen wie für den Menschen giftige Beeren. Im ausgehenden Winter und im Frühling werden vermehrt Sprosse und frische Blättchen aufgenommen. Zur Verdauung werden eins bis fünf Millimeter große Kieselsteine (Gastrolithen) oder in deren Ermangelung Teile von Schneckenhäusern oder kleine Knochen aufgenommen. Zur Fortpflanzungszeit werden von den Weibchen vermehrt kalkhaltige Kiesel geschluckt, die am Geschmack erkannt werden.
Die Nahrungssuche erfolgt überwiegend am Boden, wobei teils mit den Füßen in der Erde gescharrt, zu einem überwiegenden Teil aber in seitlicher Bewegung mit dem Schnabel gegraben wird. Dabei arbeitet sich der Vogel auch bisweilen durch bis zu 50 cm tiefen Neuschnee. Hängende Beeren teils vom Boden hochspringend, teils aber auch sitzend in Bäumen und Sträuchern abgeerntet. Oft wird die Nahrung in Form winziger Bestandteile aufgepickt, aus größeren Früchten werden Stücke herausgebissen.
Mauser
Die Mauser der Altvögel ist eine sog. Vollmauser (Das Klein- und Großgefieder wird vollständig ersetzt, alle oder fast alle Federn werden bei der Mauser gewechselt.) Die Vollmauser findet nach der Fortpflanzungszeit ab Juni oder Juli statt und ist meistens bis September, manchmal erst im Oktober abgeschlossen. Hennen mausern in der Regel etwas später als Hähne, ein Grund hierfür wird darin gesehen, dass die Weibchen, trotz gemeinsamer Jungenpflege, durch die Eiproduktion mehr Energie aufwenden müssen. Die Jugendmauser (Mauser der Jungvögel nach dem Ausfliegen, diese ist meist eine Teilmauser.) setzt etwa zur selben Zeit ein, wie die Mauser der Hennen. Mit etwa 170 Tagen sind die Jungvögel weitgehend ausgefiedert. Das Großgefiederwachstum ist aber erst einen Monat später abgeschlossen.
Fortpflanzung
Der Lichtervogel nistet in Felswänden und auf sehr hohen Bäumen. Nistplätze an Felsen liegen meist in Höhlungen oder unter Überhängen, in Ausrichtung zur Hauptwindrichtung werden deutlich gemieden. Ein (Felsen-)Horst wird flach und oval begonnen, Horste auf Bäumen sind meist runder und werden bereits anfangs höher gebaut. Felsnester messen im Mittel 2,66 m x 2,12 m und sind 1,6 Meter hoch, Baumhorste haben im Mittel einen Durchmesser von 2,8 Meter und sind 2,2 Meter hoch. Je nach Dauer der Nutzung werden die Horste ständig erweitert, ergänzt und repariert, so dass über Jahre hinweg mächtige, nicht selten mehr als vier Meter in Höhe und Breite messende Horste entstehen können. Das Nest wird aus kräftigen Ästen und Zweigen angelegt und mit belaubten Zweigen und Büscheln ausgepolstert. Diese Polsterung wird während der gesamten Brutsaison ausgebaut. Die von beiden Tieren erbauten Horste werden mehrjährig benutzt, und meist hat ein Paar mehrere sogenannte Wechselhorste. Im Gebirge liegen die Horstplätze meist unterhalb der Nahrungsgründe, da der Transport der Nahrung nach unten einfacher ist als nach oben.
Lichtervögel werden erst mit etwa sieben Jahren geschlechtsreif. Brutpaare führen, soweit bekannt, eine monogame Dauerehe. Die Balz beginnt im November mit der Wanderungen, der noch Partnerlosen Weibchen. Gelangen diese in ein Revier eines Partnerlosen Männchens, werden sie mit einem speziellen Balzruf begrüßt. Erwidert das Weibchen den Balzruf, beginnt das eigentliche Balzritual. Die Männchen fliegen auf das Weibchen mit hoher Geschwindigkeit zu, dass Weibchen erwidert dies, sodass beide Vögel frontal aufeinander zufliegen. Kurz bevor sie zu kollidieren scheinen, wechseln beide Vögel in den Steigflug. Dieser ist ungewöhnlich senkrecht und erinnert fast schon an einen Raketenstart. Die beiden Vögel steigen immer weiter auf, dabei drehen sie sich umeinander ohne ins Trudeln zu geraten. Durch die sich ablösenden Federpartikel entstehen so zwei in sich gewundene Regenbögen, sog. Regenbogenband. Erreichen die beiden Vögel den Teil der Atmosphäre in der Luftfeuchtes Wasser zu gefrieren beginnt, beenden sie ihren Steilflug, indem sie auf gleicher Höhe stoppen. Dort schlagen die Lichtervögel kräftig mit ihren Flügeln, sodass ihre färbenden Schwanzschleppenpartikel in Wellen durch die Atmosphäre geistern (Was zu Phänomen wie Polarlichtern führt). Ist diese Prozedur beendet, nähern sich beide Vögel im Flug an und greifen sich mit ihren Füßen aneinander. Unfähig so zu fliegen, stürzen sie trudelnd in die Tiefe. Dabei wird das sich gebildete Regenbogenband verwirbelt. Kurz bevor die Lichtervögel auf dem Boden aufschlagen, lassen sie voneinander los und fliegen Richtung Horst - der Bund fürs Leben ist somit geschlossen.
Die Eiablage erfolgt mit höherem Breitengrad immer später, im Süden Belletristicas im Mittel Anfang Dezember, im Norden des Kontinents Anfang Mai. Das Weibchen legt im Abstand von drei bis vier Tagen meistens zwei Eier, seltener nur eines oder drei. Die kurzspindelförmigen Eier sind glanzlos und meist goldfarben mit gräulicher Fleckung oder gar keinem Muster. Eier messen im Mittel 160 x 120 Millimeter. Das Gelege wird ab dem ersten Ei überwiegend vom Weibchen bebrütet, das Weibchen wird während der Brut vom Männchen mit Futter versorgt. Die Brutzeit dauert 86 bis 90 Tage.
Die frisch geschlüpften Lichtervögel haben ein weißes Daunenkleid, das zweite Daunenkleid wird im Alter von 9 bis 15 Tagen angelegt, und besitzt eine reflektierende Schicht, so sind die Jungvögel für meisten Augen, außer in nächster Nähe, praktisch unsichtbar. Etwa sieben Wochen nach dem Schlüpfen können die Jungvögel selbst Sämereien zerteilen. Bis dahin werden sie vom Weibchen mit vom Männchen an den Horst gebrachter Nahrung gefüttert. Im Alter von 74 bis 80 Tagen absolvieren die Jungvögel die ersten erfolgreichen Kurzflüge. Die Jungvögel verbringen die ersten 60 bis 70 Tage nach dem Ausfliegen in der unmittelbaren Nestumgebung; etwa 5 Monate nach dem Ausfliegen verlassen die Jungvögel das Revier der Eltern.
Das Höchstalter von Lichtervögeln liegt bei etwa 77 Jahren.
Gefährdung
Der Lichtervogel war nicht immer ein Vogel der Gebirge, doch Nachstellung reduzierte sein Vorkommen im Tiefland so sehr, dass sich der Vogel in seiner Verbreitung auf die Gebirge von Belletristica beschränkte. Es ist unklar in wie weit die Winterdämonen in grauer Vorzeit Nachstellungen betrieben, da dieser Vogel eine besondere Abneigung gegen jene Kreaturen
besitzt.
Systematik
Taxonomische Synonyme
- Lux xandrai (Lichtervogel) Felix 2016
Kulturelle Bedeutung
Es gibt viele Legenden über den Mythenumwobenen Lichtervogel. Man betrachtet ihn, da er einen Regenbogen während des Fluges hinter sich herzieht, als Bote von Glück und einen Schutzpatron der Lüfte.
Im Allgemeinen wird der Lichtervogel als der Bote des Frühlings verstanden, wandern die Jungvögel von ihren elterlichen Revieren aus, bringen sie den Frühling vom Berg ins Tal. Dieser folgt der Regenbogenspur des Vogels und würde mit diesem auch den Berg herauf klettern, doch hat der Frühling im Tal bereits das wachsen begonnen und ist zu schwer für den Vogel geworden. So lässt der Lichtervogel den Frühling im Tal zurück, bevor die Jungvögel im nächsten Jahr den neuen Frühling ins Tal bringen.
In einer Legende heißt es, dass ein User sich einst von einem Gewitter überrascht wurde, die drohend schwarzen Wolken hatten den armen User bereits erreicht, da zuckte ein Blitz auf ihn herab und traf den User. Ein farbloser Vogel der dies beobachtet hatte, flog rasch zu dem verwundeten um ihm mit seinen großen Schwingen Schutz zu bieten. Vom Regen durchnässt, musste der Vogel mit ansehen, wie der User starb. Der Vogel, der diesen User nicht kannte, trauerte um seinen Verlust. Da beendete der Himmel seine Blitze. Nun fielen nur noch die Tränen des farblosen Vogels und sie erreichten, da der Wind nicht mehr blies, den Körper des Users, dieser erwachte nach kurzer Zeit zu neuem Leben. Der User dankte dem Vogel , dieser erhob sich in den sich nun öffnenden Himmel. Und da geschah es: Aus den Wolken die noch vor kurzem tödliche Blitze geschleudert hatten, regnete es sieben Farben auf den Vogel herab. So kam der Lichtervogel zu seinen Farben und seiner Funktion als Schutzpatron.
Eine weitere Legende besagt, dass wenn ein Lichtervogel stirbt er sich in sieben einfarbige Vögel spaltet. Deren Farben sind: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Treffen diese Vögel in einer Polarlichtnacht wieder aufeinander (bzw. werden alle sieben Vögel vom gleichen Lichtstrahl getroffen), wird der Lichtervogel von eins wiedergeboren.
Anmerkungen
Xandra erwähnt eine Begegnung mit einem Lichtervogel in "Düstere Jungfer" https://belletristica.com/de/text/d%C3%BCstere-jungfer-8519