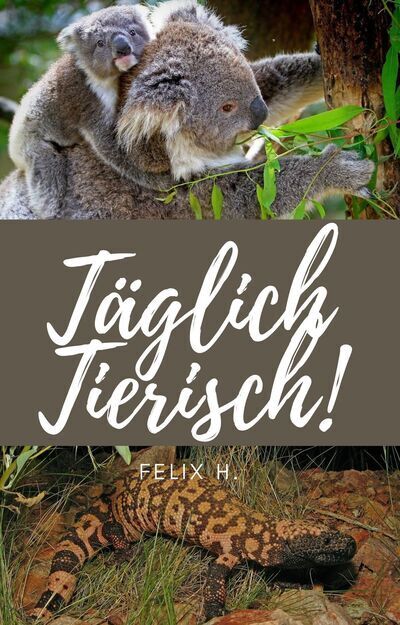Ein Großteil der Lebensgeschichte des Europäischen Aals (Anguilla anguilla) war jahrhundertelang ein Rätsel, da Fischer nie etwas fingen, das sie als jungen Aal identifizieren konnten. Anders als viele andere Wanderfische beginnen Aale ihren Lebenszyklus im Meer und verbringen den Großteil ihres Lebens in Süßwasser im Inland oder brackigem Küstenwasser. Zum Laichen kehren sie ins Meer zurück und sterben dann.
Anfang des 20. Jahrhunderts identifizierte der dänische Forscher Johannes Schmidt die Sargassosee als wahrscheinlichsten Laichplatz des Europäischen Aals. Dort schlüpfen auch die Aallarven aus den Eiern, welche wegen ihrer Form Weidenblattlarven (Leptocephalus-Larve) genannt werden. Etwa 300 Tage brauchen diese Larven, um von der Sargassosee an die europäischen Küsten zu gelangen. Früher nahm man an, dass die winzigen Larven sich passiv vom Golfstrom treiben lassen würden, tatsächlich schwimmen die Larven aktiv in Richtung Europa.
Etwa 100 Kilometer vor der europäischen Küste beginnt die Metamorphose der Weidenblattlarven zu den etwa 7 Zentimeter langen Glasaalen und dringen in Flussmündungen ein und viele beginnen, flussaufwärts zu wandern. Nachdem sie ihren kontinentalen Lebensraum erreicht haben, verwandeln sich die Glasaale in Steigaale, Miniaturversionen der erwachsenen Aale. Wenn der Aal wächst, wird er aufgrund der bräunlich-gelben Farbe seiner Flanken und seines Bauches als "Gelbaal" bezeichnet.
Nach 5 bis 20 Jahren in Süß- oder Brackwasser werden die Aale geschlechtsreif, ihre Augen werden größer, ihre Flanken werden silbern und ihre Bäuche weiß. In diesem Stadium werden die Aale als "Silberaale" bezeichnet und beginnen ihre Wanderung zurück in die Sargassosee, um zu laichen. Die Versilberung ist für die Entwicklung eines Aals wichtig, da sie erhöhte Werte des Steroidhormons Cortisol ermöglicht, das für die Wanderung vom Süßwasser zurück ins Meer erforderlich ist. Das Cortisol spielt bei der langen Wanderung eine Rolle, da es die Mobilisierung von Energie während der Wanderung ermöglicht. Eine weitere Schlüsselrolle bei der Versilberung spielt die Produktion des Steroids 11-Ketotestosteron (11-KT), das den Aal auf strukturelle Veränderungen der Haut vorbereitet, um die Wanderung vom Süßwasser ins Salzwasser zu überstehen.
Vermutlich finden sie den Weg über Magnetorezeption.
Bei dieser letzten Wanderung werden innerhalb eines Jahres teilweise Strecken von über 5000 Kilometern ohne Nahrungsaufnahme gegen den Golfstrom zurückgelegt. Tagsüber schwimmen die Tiere in den kühlen Wassern zwischen 200 und 1000 Metern Tiefe und nachts schwimmen sie in den wärmeren Oberflächenbereichen. Dabei legen die Aale zwischen Irland und den Bahamas auf den ersten 1300 Kilometern nur 5 bis 25 Kilometer pro Tag zurück, viel weniger als die 35 Kilometer, die nötig wären, um innerhalb eines Jahres die Strecke von 5000 km zu bewältigen. Daraus folgert man, dass die Aale später Wasserströmungen ausnutzen, die ihnen dann eine höhere Tagesgeschwindigkeit ermöglichen, doch bestätigt ist diese Annahme bisher nicht. Es bleibt also weiterhin spannend und mysteriös beim Aal.
Erreichen die Tiere die Sargassosee laichen sie ab und sterben.
Manchmal gelangt der Aal nie ins Süßwasser und bleibt sein ganzes Leben lang in seiner Meeresumgebung. Andere wachsen in Brackwasser auf oder wandern im Laufe ihres Lebens mehrmals zwischen Salzwasser, Brackwasser und Süßwasser.
Quellen
- Schmidt, Johs. (1912). "Danish Researches in the Atlantic and Mediterranean on the Life-History of the Freshwater-Eel (Anguilla vulgaris, Turt.). With notes on other species.) with Plates IV—IX and 2 Text-figures". Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 5 (2–3): 317–342. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.19120050207 Abgerufen am 18.10.2024
- "FAO Fisheries & Aquaculture Anguilla anguilla". Fao.org. 1 January 2004. https://www.fao.org/fishery/en/culturedspecies/Anguilla_anguilla/en%23tcN90078 Abgerufen am 18.10.2024
- Balm, S. Paul; Durif, Caroline; van Ginneken, Vincent; Antonissen, Erik; Boot, Ron; van Den Thillart, Guido; Verstegen, Martin (2007). "Silvering of European eel (Anguilla anguilla L.): seasonal changes of morphological and metabolic parameters". Animal Biology. 57 (1): 63–77. https://brill.com/view/journals/ab/57/1/article-p63_6.xml Abgerufen am 18.10.2024
- Dufour, Sylvie; Ginneken, Vincent van; Durif, Caroline; Doornbos, Jorg; Noorlander, Kees; Thillart, Guido van den; Boot, Ron; Murk, Albertinka; Sbaihi, Miskal (1 January 2007). "Endocrine profiles during silvering of the European eel (Anguilla anguilla L.) living in saltwater". Animal Biology. 57 (4): 453–465. https://brill.com/view/journals/ab/57/4/article-p453_7.xml Abgerufen am 18.10.2024
- Lokman, P. Mark; Vermeulen, Gerard J.; Lambert, Jan G.D.; Young, Graham (1 December 1998). "Gonad histology and plasma steroid profiles in wild New Zealand freshwater eels (Anguilla dieffenbachii and A. australis) before and at the onset of the natural spawning migration. I. Females*". Fish Physiology and Biochemistry. 19 (4): 325–338. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1007719414295 Abgerufen am 18.10.2024
- The evolving story of catadromy in the European eel (Anguilla anguilla) https://academic.oup.com/icesjms/article/80/9/2253/7283903?login=false Abgerufen am 18.10.2024
- "Eels May Use 'Magnetic Maps' As They Slither Across The Ocean". NPR. 13 April 2017. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/04/13/523450769/eels-may-use-magnetic-maps-as-they-slither-across-the-ocean Abgerufen am 18.10.2024
- K. Aarestrup, F. Okland, M.M. Hansen, D. Righton, P. Gargan, M. Castonguay, L. Bernatchez, P. Howey, H. Sparholt, M. Pedersen, R.S. McKinley: Oceanic spawning migration of the European Eal (Anguilla anguilla). Science, Sep 25, 2009;325:1660.
- Der Europäische Aal (Anguilla anguilla) BUND, https://www.bund-sh.de/tiere-pflanzen/aale/ Abgerufen am 18.10.2024